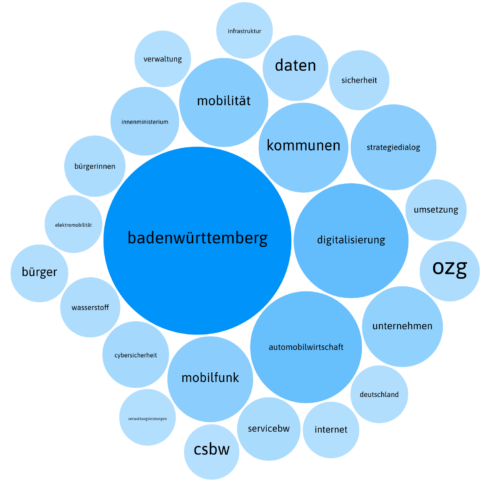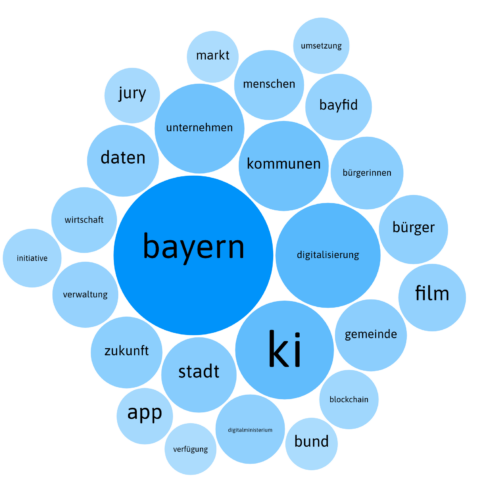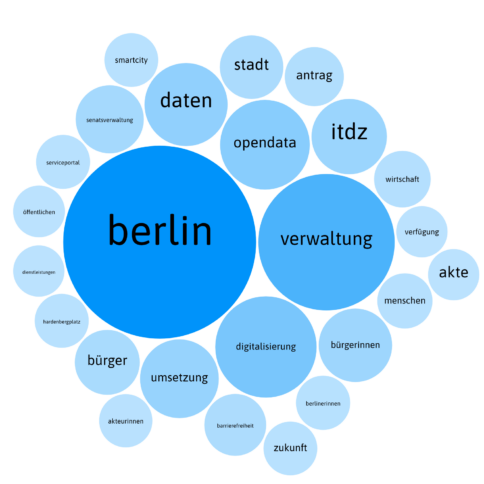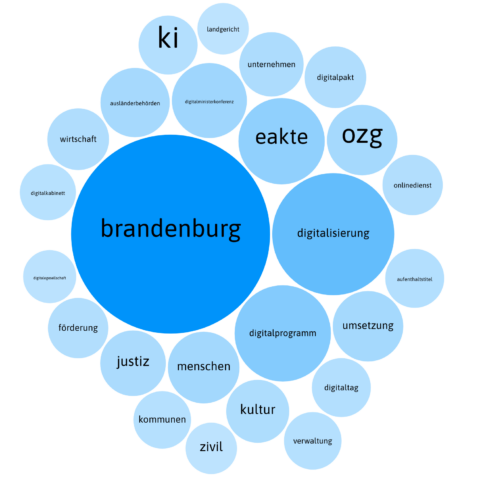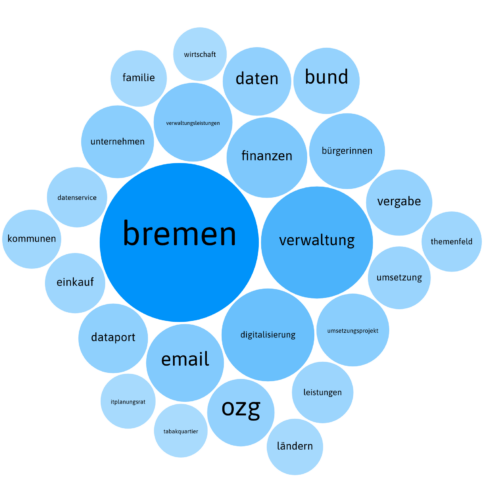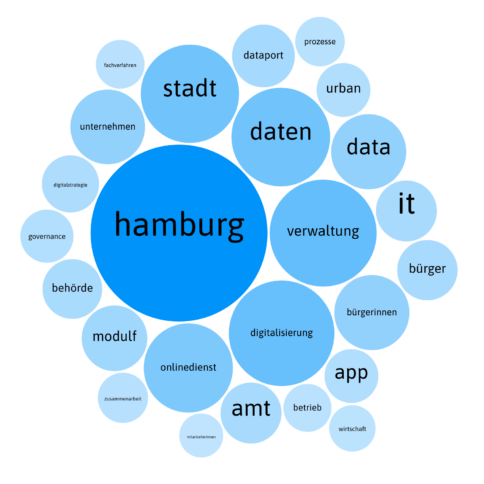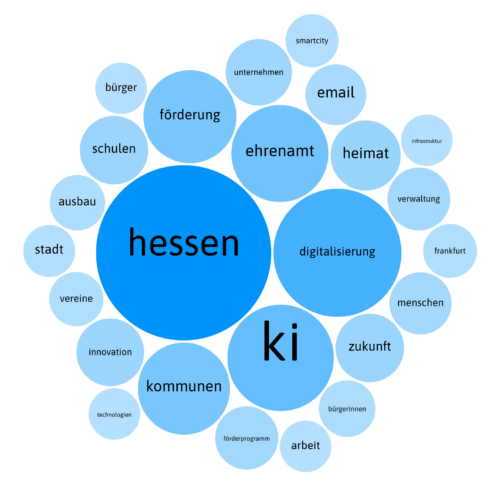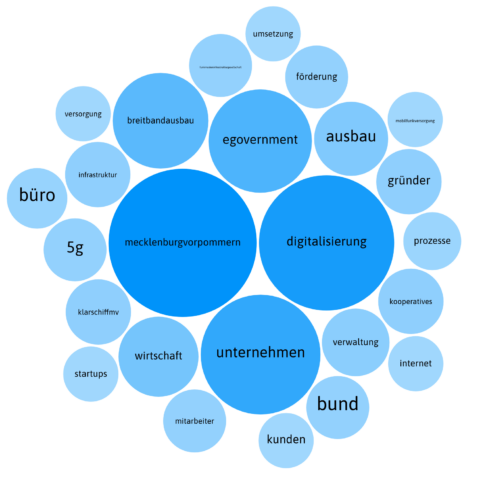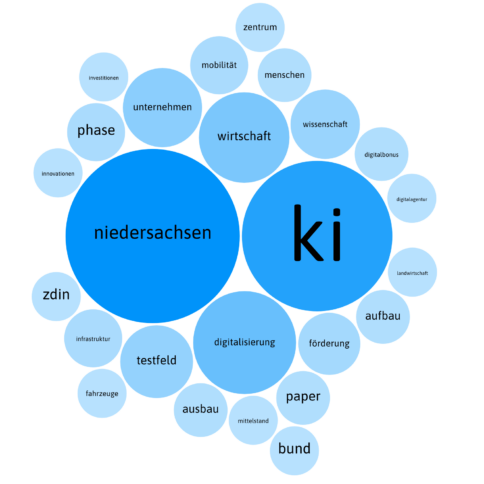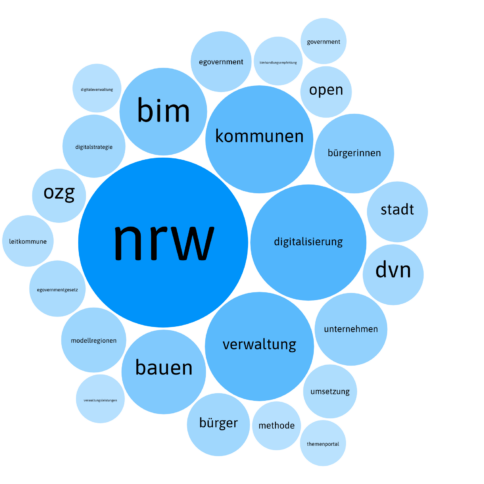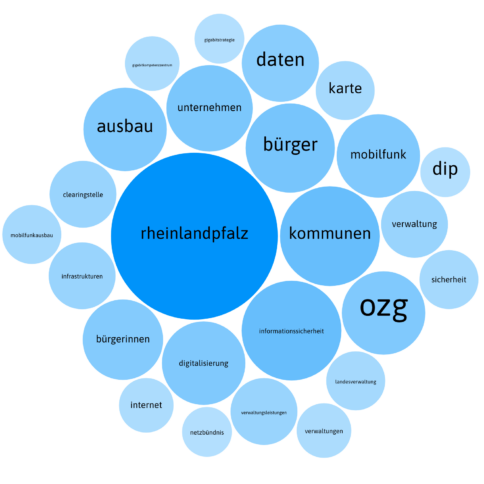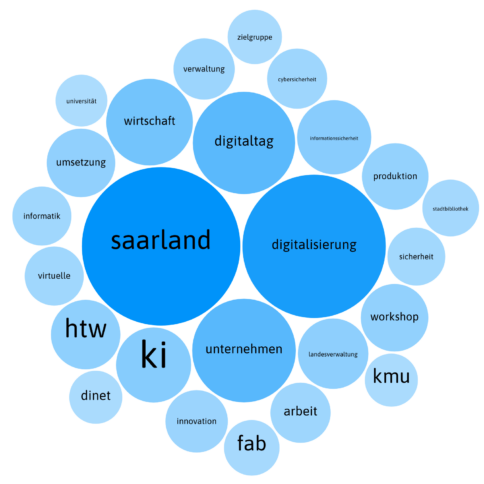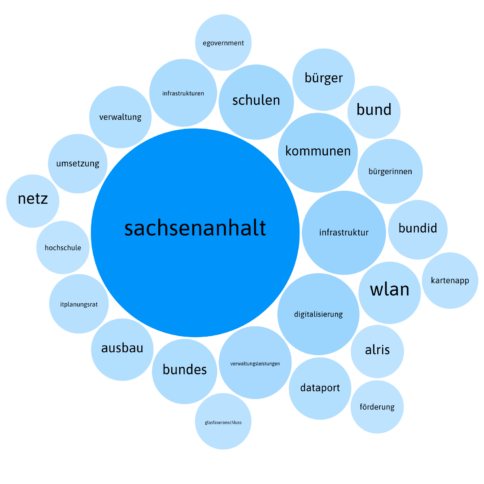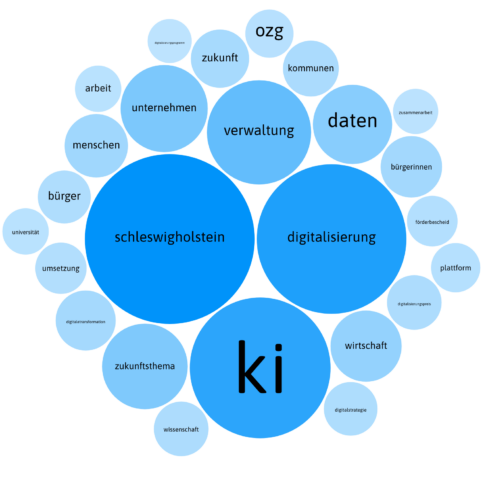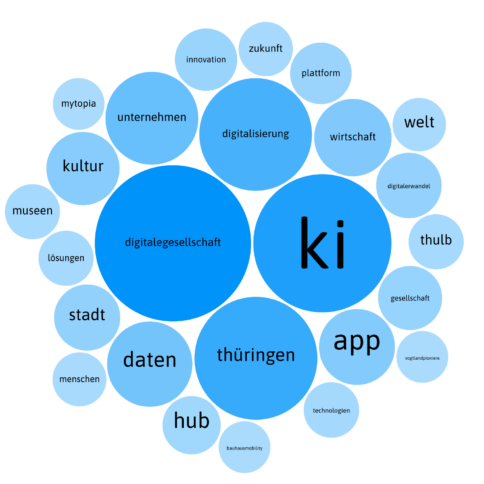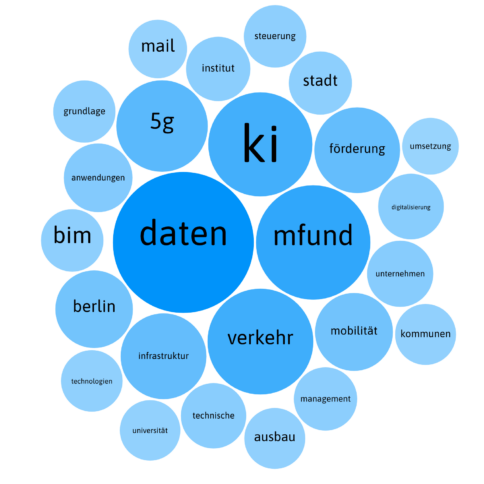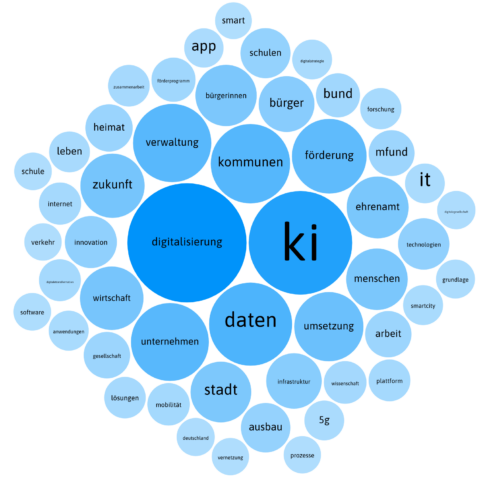netzpolitik.org

Olaf Scholz sucht mit seinem neuen TikTok-Kanal mehr Social-Media-Reichweite. Aber nicht alles, was funktioniert, ist auch rechtlich zulässig. In einem Gastbeitrag analysieren Tobias Keber und Clarissa Henning, ob die neue Social-Media-Präsenz des Bundeskanzlers ein Verstoß gegen den Datenschutz ist.

Dies ist ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Tobias Keber, seit 2023 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, und Dr. Clarissa Henning, der persönlichen Referentin des Landesdatenschutzbeauftragten. Gastbeiträge geben nicht zwangsläufig die Haltung der Redaktion wider.
Der rechtswissenschaftliche Diskurs hat TikTok für sich entdeckt. Während Stefan Brink als ehemaliger Landesdatenschutzbeauftragter Baden-Württembergs dem TikTok-Kanal des Bundeskanzlers einen Verstoß gegen Datenschutz und politische Neutralität bescheinigt, kontert die Datenschutzblase mit Kristin Benedikt und Rolf Schwartmann mit einer weitreichenden Widerlegung der Argumente.

Zugegeben, auch dieser Artikel ist Zeugnis davon und reiht sich in die jüngsten Überlegungen zu dem trendigen Dienst von ByteDance ein, der Elemente eines Videoportals und Funktionen eines sozialen Netzwerks nahtlos verschmelzen lässt.
Neu sind die mit dem Dienst verbundenen (nicht nur) datenschutzrechtlichen Fragen dabei nicht. Ventiliert sind sie im Zusammenhang mit Diensten von Meta auf nationaler und europäischer Ebene, instanzgerichtlich ebenso wie höchstrichterlich. Sind die in diesem Rahmen elaborierten Grundsätze zur gemeinsamen datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit für über Social-Media-Präsenzen geführte Kommunikation auf „New Social Media“-Angebote wie TikTok übertragbar?

Neu ist jedenfalls: Jetzt ist der Bundeskanzler auf TikTok. Und der Gesundheitsminister. Und der Wirtschaftsminister. Sie folgen einem Trend, der sich im politischen Raum schon seit einiger Zeit abzeichnet und nun weiter Fahrt aufnimmt, da es auf die Europawahl und wie hierzuländle (in Baden-Württemberg) vielerorts auch auf die Kommunalwahlen zugeht. Von allen Seiten strömen Parteien, Politiker*innen und Behörden auf TikTok – schließlich will und muss man die Jungwähler*innen, die GenZ, erreichen, um sie nicht einseitig informiert zu sehen. Das ist ein nachvollziehbarer und gewichtiger Grund. Denn man muss Bürger*innen ja dort abholen, wo sie sind – oder nicht?
Diktat der Reichweite?
Nicht alles, was funktioniert, ist rechtlich zulässig. Das klingt trivial, gilt im Besonderen aber, wenn öffentliche Stellen mit Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Zentrales Element des öffentlich-rechtlichen Äußerungsrechts ist, dass eben nicht jede Form der Kommunikation erlaubt und Grenzen deutlich enger gesteckt sind, als das bei Privaten der Fall ist. Bürger*innen können sich staatlichen Entitäten gegenüber auf die Meinungsfreiheit berufen, umgekehrt geht das nicht. Zur individuellen Meinungs- und Informationsfreiheit im Verhältnis Bürger-Staat gehört die freie Wahl des Kommunikationsmittels, umgekehrt gilt das in dieser Form nicht.
Vor diesem Hintergrund durchläuft das Reichweitenargument mediensystemisch gleich mehrere Déjà-vus. Das erste Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts durchkreuzte 1961 den Plan Konrad Adenauers, ein eigenes Fernsehprogramm zu etablieren. Der durch Medien vermittelte Meinungsbildungsprozess in einer Demokratie müsse staatsfern ausgestaltet sein, so die Karlsruher Richter. Als Angela Merkel dann 2015 dem YouTuber Le Floid reichweitenstark Rede und Antwort stand und mit einem Auge zwinkernd anmerkte, das Internet ermögliche es dem Grunde nach, dass man sich seinen eigenen Sender baue, der nur Unkritisches zu berichten habe, stellte sich die Frage erneut. Diskutiert wurde sie indes schon deutlich leiser, denn mit der Situation in den Sechziger Jahren, wo für die Verbreitung medialer Inhalte nur begrenzte Ressourcen (Funkfrequenzen) bestanden haben, sei die Situation im Internet nun wirklich nicht zu vergleichen, so das Argument.
Auch in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie hat indes noch Gültigkeit, dass hoheitliche Kommunikate auf das für die Öffentlichkeitsarbeit Erforderliche begrenzt sein müssen und dem Sachlichkeits- sowie Neutralitätsgebot verpflichtet sind. Wie weit Neutralität, Sachlichkeit und Seriosität miteinander verknüpft sind und die Aktentasche des Kanzlers als tauglicher Gegenstand der Darlegung der aktuellen und künftigen Politik beziehungsweise Erläuterung der Amtsgeschäfte erscheinen kann, soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden.
Fragen der Datenschützer
Was eigentlich haben denn nun speziell die Datenschützer*innen mit TikTok für ein Problem? Wird hier nicht einfach die nächste Sau notorischer Bedenkenträger durchs Digitalisierungsdorf getrieben? Analysieren wir nüchtern und lesen zunächst, was das Unternehmen selbst im Rahmen seines Hausrechts (Terms of Service) und in der Datenschutzerklärung kundtut.
TikTok macht keinen Hehl daraus, dass Inhalte von Direktnachrichten erhoben werden, ebenso wie die dazugehörigen Meta-Daten (zum Beispiel Zeitpunkt des Versands, des Empfangs und des Lesens der Nachricht und deren Kommunikationsteilnehmer*innen), Standortdaten (auch soweit sie durch den Nutzenden deaktiviert werden) und das Nutzungsverhalten. Außerdem gleicht TikTok beim Synchronisieren des Telefonbuchs alle bei Nutzer*innen gespeicherten Informationen zu Kontakten mit den bestehenden TikTok-Nutzer*innen ab. Diese Vorgaben akzeptieren Nutzende im Rahmen des Registrierungsprozesses. Ob dies aber eine wirksame Einwilligung nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) darstellt, kann man zurecht fragen.
Öffentliche Stellen unterstreichen in der die Eröffnung eines TikTok-Kanals begleitenden Kommunikation gerne, man nehme Datenschutz und Datensicherheit ernst und betreibe daher ein eigenes Endgerät für den Betrieb des Kanals. Das erscheint bemüht, adressiert immerhin das in der Datenschutzerklärung beschriebene Problem des Auslesens von Kontaktdaten (Dritter) und erscheint auch datensicherheitsrechtlich (Endgerät außerhalb des internen Kommunikationsnetzes) sinnvoll. Für die Datenverarbeitungsvorgänge der auf die behördlichen TikTok-Inhalte zugreifenden Nutzenden ist diese technisch organisatorische Maßnahme indes ohne Wirkung.
Auf dem TikTok-Kanal des Bundeskanzlers ist zu lesen: „Für den TikTok-Kanal TeamBundeskanzler […] hat das BPA die TikTok-Analytics-Funktion deaktiviert. Das heißt, TikTok stellt dem BPA keine Seitenstatistik, die anonymisiert Aufschluss über Besuchergruppen und Besucheraktivitäten gibt, zur Verfügung. Das sog. ‚TikTok Analytics Joint Controller Addendum‘ gilt daher für diesen Informationsdienst nicht.“
Das liest sich vor dem Hintergrund der einschlägigen EuGH-Rechtsprechung problembewusst, wirft aber die Frage auf, ob das Deaktivieren der Analyse-Funktion durch den Präsenz-Betreibenden bewirkt, dass diese Daten von TikTok tatsächlich nicht mehr erhoben werden. Oder verzichtet der Kanalbetreibende bloß auf die Einsichtsmöglichkeit in die gleichwohl durch TikTok über seine Präsenz erhobenen Daten? Aus den Augen, aus dem Sinn. Aus der Mitverantwortung?
Was erfasst TikTok über den In-App-Browser?
Wenig offizielle Informationen, namentlich in der Datenschutzerklärung des Unternehmens, findet man zum Verhalten des In-App-Browsers des Dienstes, der gleichsam wenig datensparsam ausgestaltet ist. Klickt man in der TikTok-App auf einen Link, der in TikTok (etwa in der Kanalbeschreibung) gepostet wurde, wird dieser mittels des In-App-Browsers geöffnet, wodurch zahlreiche Daten an TikTok übermittelt werden, die mit dem User oder der Userin verknüpft werden, beispielsweise die vollständige URL, Zeitstempel und den Verlauf der Seiten, die im Browser aufgerufen werden. Das Nutzungsverhalten wird in einer Log-Datei auf dem Endgerät gespeichert und kann vom Dienstanbieter TikTok ausgelesen werden.
Um das Problem veranschaulicht zu benennen: TikTok erfasst bei öffentlichkeitsarbeitenden Kanälen über den In-App-Browser auch, welche politischen Inhalte und Meinungen (besondere Kategorien personenbezogener Daten, Art. 9 DSGVO) der Kanalbesucher konsumiert werden. Im Lichte der Ausführungen im Hausrecht TikToks, wonach auch die Konten von Politiker*innen, Parteien, Regierung etc. als solche kategorisiert werden (die Kriterien hierfür und was daraus folgt, sind nicht transparent), erscheint das radikal konsequent.
Aus dem Bundeskanzleramt Olaf Scholz’ heißt es, dass man auf TikTok unterwegs sei, bedeute nicht, dass man die dort herrschenden Datenschutzpraktiken befürworte. Das ist erfreulich, nimmt man die kognitiven Verzerrungen durch TikTok-Algorithmen in den Blick, die natürlich direkten Einfluss auf die Meinungsbildung haben und damit nichts mit Selbstbestimmung (schon gar nichts mit informationeller) zu tun haben. Aber ist das Haltung, die wir von staatlichen Einrichtungen erwarten? Um es mit Jan Böhmermann zu sagen: „Wer die Leute da abholen will, wo sie sind, muss auch wissen, wo er die Leute hinbringt.“
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Die Vorstellung des Bundeslagebilds zur Cyberkriminalität lief ab wie immer: Warnungen vor der Lage, flankiert von Forderungen nach mehr Befugnissen. Doch solange die Verantwortlichen sich nicht für grundlegende IT-Sicherheitsprinzipen einsetzen, ist das Mahnen vor allem eines: unglaubwürdig. Ein Kommentar.

Auf manche Traditionen ist Verlass. Zum 1. Mai berichten Medien verstärkt über Arbeitsbedingungen. Anlässlich des Black Fridays gibt es massenweise Schnäppchentipps, durchbrochen von konsumkritischen Kommentaren. Und die jährliche Vorstellung des Bundeslagebilds Cybercrime – wenn auch kein Feiertagsanlass – flankieren Texte über die Bedrohungen aus dem Internet.
Heute war es wieder Zeit für das alljährliche Ritual zur Cyberkriminalität „im engeren Sinne“. Denn im vorgestellten Lagebild geht es nicht um die Straftaten, bei denen jemand mit einer Online-Landkarte Fahrradparkplätze ausfindig gemacht hat, um dann mit dem Bolzenschneider loszuziehen. Sondern es geht um solche Kriminalität, die sich direkt gegen IT-Systeme richtet.
Das sind beispielweise Ransomware-Infektionen, bei denen dann die Systeme eines Krankenhauses außer Betrieb gesetzt und Unternehmen erpresst werden. Oder wenn jemand bei Banken Daten abgreift, um sie für kriminelle Zwecke zu verkaufen. Oder, nach Verständnis des BKA, auch „Hacktivismus“, im Bericht vor allem in Form von DDoS-Angriffen, die Websites und Dienste lahmlegen.
Die gewohnten Phrasen
Inhaltlich war es, wie beinahe jedes Jahr, wenig aufregend. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Übersicht gemeinsam mit BKA-Chef Holger Münch und BSI-Präsidentin Claudia Plattner vorgestellt. Es fielen die gewohnten Phrasen. Faeser verweist auf das große Dunkelfeld mit dem obligatorischen Eisberg-Bild und sagt den Satz, den man immer sagen muss: „Die Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit bleibt hoch.“ Münch verweist rollengerecht auf Ermittlungserfolge, Plattner auf notwendiges Bewusstsein bei Unternehmen und Bevölkerung.
Der Trend, so das Lagebild, weise sogar ein bisschen nach oben. Ein bisschen wie immer, nur schlimmer also. Vor allem bei den sogenannten Auslandstaten, denn die stiegen laut der Erhebung um 28 Prozent. Wobei das genau genommen nur aussagt, dass man nicht so recht weiß, wo die Täter:innen eigentlich sitzen. Vielleicht sind sie ja auch in Deutschland, aber gut genug getarnt. Dann werden sie statistisch als Auslandstaten erfasst. Eine Kategorie für Taten mit unbekannter Herkunft? Fehlt.
Die Straftaten, von denen man zu wissen glaubt, dass sie aus dem Inland kommen, „stagnieren auf hohem Niveau“. Und da haben sie etwas gemeinsam mit den Vorstellungen der Bundesregierung, wie man das ändern könnte. Denn auch heute kaute besonders Innenministerin Faeser die üblichen alten Ideen wieder und ließ dabei wichtige andere Maßnahmen außer Acht.
Mit Vorratsdatenspeicherung das Thema verfehlt
Eine Vorratsdatenspeicherung, da bleibt sich Faeser treu, fordert sie direkt und vehement ein. Vom neuesten Urteil des Europäischen Gerichtshofs fühlt sie sich in ihrer Meinung gestärkt. Das Problem ist jedoch: Eine Vorratsdatenspeicherung verhindert keinen Cyberangriff. Noch dazu hat sie mit Cyberkriminalität im engeren Sinne – und darum geht es ja im Lagebild – direkt nichts zu tun. Das zeigen auch Faesers eigene Beispiele, etwa Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Hier weicht die Innenministerin zugunsten ihrer Agenda deutlich vom Thema ab.
Wenn es hingegen um Maßnahmen geht, mit denen Cyberkriminalität im engeren Sinne bekämpft werden kann, bleibt Faeser auf der Pressekonferenz teilweise so nebulös wie das beschworene Dunkelfeld bei den den entsprechenden Straftaten.
Zwar will die Innenministerin „weitere Maßnahmen schaffen, die es dem Bund erlauben, bei schweren Cyberangriffen schnell zu handeln“ und sie erfolgreich abwehren. Aber welche sind das? Das verrät Faeser nicht und so kommen Assoziationen an die kontroverse Hackback-Diskussion auf. Momentan fordern zwar vor allem CDU-Politiker das Zurückhacken als Reaktion darauf, dass russischer Hacker jüngst mutmaßlich die Infrastruktur der SPD angegriffen haben. Doch auch Faeser fiel bereits früher durch Sympathien für die Gegenangriffe auf.
Konkret wiederholt sie das auf der Pressekonferenz zwar nicht. Sie will sich jedoch, so verspricht sie, für „die notwendigen Instrumente“ einsetzen.
„Keine Straftat ist uns die liebste Straftat“
Holger Münch spricht wie Claudia Plattner schon mehr darüber, wie man mehr reale IT-Sicherheit bekommen könnte – durch resiliente Systeme und Prävention. (Auch wenn sich Münch den Verweis auf notwendige Gesetzesänderungen nicht nehmen lässt, damit das BKA mehr Gefahrenabwehrbefugnisse ausüben darf.) „Keine Straftat ist uns die liebste Straftat“, so der BKA-Chef. Man könnte auch in Tradition von IT-Sicherheitsforschenden sagen: „Verteidigung ist die beste Verteidigung.“
Doch auch hier bleiben wichtige Schritte, die sich ja sogar schon im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien finden, unerwähnt. Sie scheinen wenig populär zu sein und drohen in der sich dem Ende zuneigenden Regierungszeit unterzugehen. Dabei funktionieren sie ganz ohne Grundrechtseingriffe, ganz ohne IT-Sicherheitskollateralschäden. Es geht vor allem um zwei Dinge: die notwendige Reform der sogenannten Hackerparagrafen und ein konsequentes Schwachstellenmanagement.
Schweigen zu Hackerparagrafen und Schwachstellenmanagement
Bei ersterem steht die Entkriminalisierung von ethischer IT-Sicherheitsforschung im Fokus. Finden ethische Hacker:innen etwa bei Unternehmen Sicherheitslücken und melden diese verantwortungsvoll, sind sie oft vom guten Willen der Betroffenen abhängig. Reagieren die Unternehmen unsouverän, droht ihnen eine Anzeige – letztlich dafür, dass sie die gesamte IT-Welt ein bisschen sicherer machen wollten.
Dieses Problem für Sicherheitsforschende und so auch für die IT-Sicherheit insgesamt wollte die aktuelle Bundesregierung angehen, der Ball liegt beim Justizministerium. Das hat im vergangenen Jahr ein Symposium zum Thema organisiert und will in der ersten Jahreshälfte 2024 immerhin einen Gesetzentwurf vorlegen. Doch die Zeit dafür wird knapp.
Beim Schwachstellenmanagement ist im Gegensatz zu den Hackerparagrafen nicht einmal der Wille der Regierung erkennbar, zu einer konsequenten Lösung zu kommen. Dabei ist das Prinzip einfach und logisch: Wird eine Sicherheitslücke etwa durch eine Behörde entdeckt, sollte sie etwa dem zuständigen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gemeldet werden. Damit sie geschlossen werden kann. Damit hat nicht nur der Entdecker der Lücke die Chance, seine Systeme abwehrfähiger zu machen, sondern alle, die von der gleichen Lücke betroffen sind. Und das sind häufig ganz viele verschiedene Unternehmen, staatliche Behörden und Privatpersonen. Was ist das Problem?
Es gibt kein Privileg auf Sicherheitslücken
Zu dieser Konsequenz kann sich vor allem Nancy Faeser offenbar nicht durchringen. Denn Behörden wie die Polizei oder Geheimdienste haben ein Interesse daran, Schwachstellen für ihre eigenen Interessen offenzuhalten und sie beispielsweise für Staatstrojaner zu nutzen. Das aber betrifft am Ende nicht nur die IT-Sicherheit einiger Krimineller, sondern die der gesamten Gesellschaft mit kaum überschaubaren Folgen. Es gibt kein Privileg für staatliche Stellen, Sicherheitslücken nur „für das Gute“ auszunutzen.
Solange sich die Regierung nicht dazu durchringen kann, sich konsequent zum Wohl und für die IT-Sicherheit aller einzusetzen, bleibt das Raunen von der Cyberbedrohung und die Lancierung neuer Befugnisse eine traditionsgeprägte Inszenierung. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, unser aller IT-Sicherheit zu erhöhen. „Nicht klicken, sondern erst mal gucken“, fasst das Holger Münch zusammen.
Bundesinnenministerin Faeser hat indes noch ein paar mehr Möglichkeiten an der Hand. Sie könnte gemeinsam mit anderen dazu beitragen, die Sicherheitsprobleme der digitalen Welt an der Wurzel zu packen. Solange sie das aber nicht tun, bleibt das Rufen nach mehr Befugnissen vor allem eines: unglaubwürdig und bedeutungslos.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Die EU ist im Fediverse mit eigenen Servern auf Mastodon und Peertube präsent und damit fast allen Regierungen der Welt voraus. Am Samstag sollen die Server jedoch abgeschaltet werden, weil keine EU-Institution den Betrieb übernehmen will. Was danach mit den Accounts geschehen soll, ist weiter unklar.

Es ist weiter unklar, wie die EU ab kommender Woche im Fediverse vertreten sein wird. Momentan betreibt der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDPS) zwei Server für Mastodon und Peertube. Auf denen haben 40 Institutionen Accounts, darunter die EU-Kommission und der Europäische Gerichtshof. Vor einigen Wochen kündigte der Datenschutzbeauftragte aber an, die Server bald dicht machen zu wollen.
Der Grund: Sie waren nur als Pilotprojekt gedacht. Dieses sollte ursprünglich nur für ein Jahr laufen, der EDPS hatte es schon um ein Jahr verlängert. „In dieser Zeit haben wir versucht, einen neuen Betreiber bei den EU-Institutionen mit mehr Kapazitäten und Ressourcen als beim EDPS zu finden“, erklärte ein Sprecher gegenüber netzpolitik.org. „Leider war keine EU-Institution verfügbar, den Betrieb des Projekts zu übernehmen.“ Deshalb wird der EDPS die beiden Server am Samstag abschalten.
Hunderttausende Follower:innen
Was dann mit den Accounts der einzelnen Institutionen passieren wird, ist weiter unklar. Der Account der Kommission hat innerhalb der letzten zwei Jahre immerhin 102.000 Follower:innen angesammelt. Auf Ex-Twitter sind es 1,8 Millionen, dort postet die Kommission aber auch schon seit 2010.
Kurz nach der Ankündigung des EDPS hatte die Kommission ein etwas kryptisches Update auf Mastodon gepostet: „Wir arbeiten an einer Lösung, um unsere kontinuierliche Präsenz auf euren Feeds zu gewährleisten, indem wir Mastodons portable Identitäten voll ausnutzen.“ Das Team hinter der Mastodon-Präsenz soll ausgebaut werden, hieß es dort.
Weiteres Vorgehen weiter unklar
Aber heißt das, dass die Kommission den Betrieb des Mastodon-Servers übernehmen will? Auf Nachfrage von netzpolitik.org hieß es wieder nur, man arbeite an einer technischen Lösung. Der EDPS hat bis heute jedenfalls nichts von Plänen der Kommission gehört, Verantwortung für die Mastodon-Präsenz der EU zu übernehmen. Der letzte Stand dort ist, dass alle Institutionen ab kommenden Samstag selber für ihre eigenen Accounts zuständig sein werden.
Auf Mastodon können Accounts relativ einfach zwischen Servern umgezogen werden. Die Institutionen müssten also keinen eigenen EU-Server betreiben, sondern könnten zum Beispiel auch auf den bei weitem größten Server mastodon.social oder den inoffiziellen EU-Politiknerd-Server eupolicy.social wechseln. Aber was wäre die Signalwirkung, wenn die EU-Institutionen nicht einmal genug digitale Souveränität hinbekommen, um einen gemeinsamen Mastodon-Instanz zu betreiben?
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Die israelische Armee soll ein KI-gestütztes System eingesetzt haben, um Ziele in Gaza zu markieren. Die Fehlerraten solcher Technologien seien groß, warnt der Verein „Forum InformatikerInnen für Frieden“ und fordert deren Ächtung. Ein Interview mit Rainer Rehak, der das Papier mitgeschrieben hat.
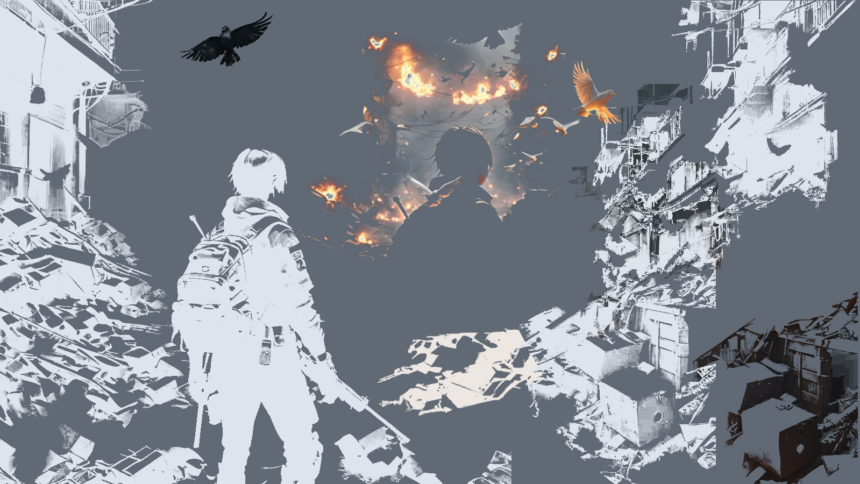
Im „Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung“ (FIfF e.V.) engagieren sich Fachleute aus der Informatik seit über 40 Jahren für Abrüstung in militärischen Anwendungen. Zuletzt forderte das FIfF e.V. gemeinsam mit, „AK gegen bewaffnete Drohnen“ sowie der „Informationsstelle Militarisierung“ in einem Positionspapier, das System „Lavender“ der israelischen Streitkräfte und andere KI-basierte Waffensysteme sollten als Kriegsverbrechen eingestuft werden.
netzpolitik.org: Wieso habt ihr euch dafür entschieden, das Positionspapier zu schreiben?
Rainer Rehak: In der Diskussion um aktuelle Kriege werden sehr viele politische, militärische, soziale, wirtschaftliche und menschenrechtliche Fragen verhandelt. Insbesondere bei den aktuell von Israel ausgehenden Angriffen mit KI-basierten Waffensystemen gibt es aber wenige Stimmen, die kompetent sowohl die Technik verstehen als auch die gesellschaftliche Einbettung nachvollziehen können.
Da wir uns in Arbeitsgruppen schon lange mit bewaffneten Drohnen, automatischen, automatisierten und autonomen Waffensystemen beschäftigen, haben wir gemerkt, dass wir uns dazu äußern müssen. Unser Vereinsmitglied Christian Heck steckt sehr tief in dem Thema drin. Er machte den Anfang und hat uns dann alle reingeholt.
„Wir haben eine ganz klare politische Forderung“

netzpolitik.org: Wen möchtet ihr mit dem Positionspapier erreichen?
Rainer Rehak: Zum einen die Zielgruppe der interessierten Öffentlichkeit. Wir wollen den Leser:innen einen differenzierteren Blick auf die Diskussion ermöglichen. Wenn von „Targeted Killing“, also gezielter Tötung oder KI gesprochen wird, klingt das oft positiv. Genauso wie die älteren Begriffe „Smart Bombs“ oder „Präzisionswaffen“. Die klingen klinisch sauber und schön. Deshalb wollten wir einordnen, was technisch dahintersteckt. Außerdem versuchen wir, die Entwicklungen in Beziehung zum historischen Kontext zu verstehen.
Zum anderen richten wir uns explizit an die Politik. Wir haben eine ganz klare politische Forderung: Die Nutzung von solchen KI-Systemen muss als Kriegsverbrechen eingestuft werden.
netzpolitik.org: Habt ihr noch weitere Forderungen, explizit an die Bundesregierung?
Rainer Rehak: Der Einsatz autonomer und bewaffneter Drohnen sollte insgesamt politisch geächtet werden. Unser Ziel ist es darauf hinzuarbeiten, dass sie völkerrechtlich genauso behandelt werden wie ABC-Waffen. Uns ist klar, dass bewaffnete Drohnen schon lange in der Welt sind. Das macht sie aber nicht richtiger. Bei autonomen Drohnen haben wir gemerkt, dass das ein besonders schwieriger Prozess ist. Es treten schon bei der Definition Probleme auf, was autonome Drohnen sind und was sie von normalen Drohnen unterscheidet.
netzpolitik.org: Um ein Ziel mit einer herkömmlichen bewaffneten Drohne anzugreifen, braucht es immer noch Menschen. Sie sind im Prozess eingebunden, wenn auch mit großer räumlicher Distanz. Bei autonomen Systemen ist das anders. Warum sollten Menschen die Entscheidungen treffen?
Rainer Rehak: Sobald gehandelt wird, muss auch irgendwer verantwortlich sein. Das trifft sowohl dann zu, wenn es schief läuft, als auch, wenn etwas richtig läuft. Wenn mit Waffen Menschen getötet werden, dann müssen sich Menschen dafür verantworten, dass sie das gemacht oder sich dafür entschieden haben.
„Ein Prozess von Verantwortungsdiffusion bei gleichzeitig zunehmender Technisierung und Komplexität“
netzpolitik.org: Ist das bei Systemen wie „Lavender“ der Fall?
Rainer Rehak: Bei diesen automatisierten Systemen, mit denen wir es jetzt zum Beispiel mit „Lavender“ zu tun haben, findet eine automatische Zielselektion statt. Trotzdem ist jemand verantwortlich. Es sind die, die gesagt haben: Wir benutzen dieses System, wir kennen alle Eigenschaften, wir machen das. Da liegt die Verantwortung nicht mehr allein bei den einzelnen Soldatinnen und Soldaten, die das auf dem Schlachtfeld einsetzen. Auch diejenigen in den Hierarchieebenen weiter oben, die Strategien entwickeln oder die politischen Ziele vorgeben, tragen Verantwortung. Es wird immer leichter, die Verantwortung an viele Stellen zu legen. Dieser Effekt wird leider auch strategisch ausgenutzt. Wir sprechen über einen Prozess von Verantwortungsdiffusion bei gleichzeitig zunehmender Technisierung und Komplexität.
Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den finde ich persönlich sehr relevant: Diese automatisierten Systeme sind ja eben keine „Präzisionswaffen“. Das zeigt auch die investigative Recherche des Journalisten Yuval Abraham. Stichproben hätten gezeigt, dass „Lavender“ in zehn Prozent der Fälle gar keine legitimen Ziele markierte. Selbst bei den Zielen, die sogenannte „legitime Ziele“ waren, genehmigte das israelische Militär, dass für jeden mutmaßlichen Hamas-Kämpfer fünf bis 20 Zivilist:innen getötet werden können.
Diese Automatisierung sorgt eben nicht dafür, dass die Waffen genauer werden, sondern dass man sie schneller und breiter einsetzen kann. Außerdem sorgt die Maschinisierung dafür, dass es einen Skalierungs-Effekt gibt, der verheerende Folgen hat.
„Wir drehen mal an ein paar Parametern und machen einfach den Fokus ungenauer.“
netzpolitik.org: Könntest du den Skalierungs-Effekt näher erklären?
Rainer Rehak: Vorher war es so, dass die israelische Führung und dann auch die israelischen Streitkräfte menschlich betriebene Zielgenerierungssysteme einsetzten. Damit konnten sie meines Wissens nach pro Tag „nur“ im einstelligen Bereich Ziele erzeugen. Diese wurden dann angegriffen, entweder vom Boden aus oder sie wurden bombardiert. In jüngerer Zeit hat die IDF angefangen, die informationsbasierten Systeme einzusetzen, um Ziele zu generieren. Jetzt konnten sie pro Tag tausende solcher Ziele errechnen und diese dann auch angreifen.
Bei „Lavender“ war es manchmal sogar so, dass sie alle aktuellen Ziele, die das System ausgespuckt hatte, angegriffen hatten, aber, salopp gesagt, trotzdem noch Bomben für den Tag übrig hatten. Deshalb sollen sie sich dafür entschieden haben, die sowieso schon geringen Genauigkeitsanforderungen noch weiter herunterzusetzen. Sie haben also an ein paar Parametern gedreht und den Fokus ungenauer gemacht, dann produziert das System weitere Ziele. Diese Möglichkeiten sind ein Beispiel für Skalierungs-Effekte.
Als Mensch würde man vielleicht auf die Karte gucken und zufällig auf Häuser zeigen. Das wäre eindeutig Willkür und ganz furchtbare Kriegspraktik. Wenn es aber eine Maschine macht, bekommt das so eine Art „Goldstaub des Gezielten“. Das stimmt aber nicht und das wissen diejenigen, die es einsetzen, auch genau. Trotzdem benutzen sie es so.
netzpolitik.org: Die Armee argumentiert damit, dass es sich um gezielte Tötungen handele. Auf der anderen Seite sind mir keine Zahlen oder Beweise dafür bekannt, dass dadurch tatsächlich Menschenleben gerettet werden konnten. Ist dir in der Debatte schon einmal aufgefallen, dass eine „gezielte Tötung“ mit Fakten belegt werden konnte?
Rainer Rehak: Eine Schwierigkeit besteht darin, an unabhängige Informationen heranzukommen. Drohnenangriffe und Bombardierungen werden in einem Krieg meist von der technologisch stärkeren Partei eingesetzt. Das haben wir gesehen beim „War on Terror“ unter Obama, bei den Drohnenangriffen in Afghanistan oder in Waziristan, einer Region in Pakistan. Erst Whistleblower wie zum Beispiel Daniel Hale oder auch Journalisten wie Julian Assange konnten aufdecken, dass öffentliche Informationen des Militärs nicht richtig sind. Man ist gewissermaßen auf einen Zufall angewiesen, wenn es um Einblicke geht, wie gut oder schlecht diese Art von Waffen funktionieren. Das macht die Evaluation extrem schwer.
Aber nach all dem, was wir bisher wissen, sind diese Waffen wahnsinnig ungenau. Wir sehen riesengroße Fehlerraten und zusätzlich noch sogenannte Kollateralschäden, das heißt getötete Menschen, die aber gar keine Ziele waren. Diese Waffen sind unpräzise und haben verheerende Folgen. Das äußert sich in den entsprechenden Todesraten, die wir bei dieser Art der Kriegsführung Israels sehen. Die Mehrheit der 37.000 Opfer waren Frauen und Kinder.
Das liegt auch an einem automatisierten Lavender-Teilsystem, das feststellen soll, wann die Zielpersonen jeweils zu Hause bei ihren Familien angekommen waren, sodass deren Wohnungen und somit auch Familien bombardiert werden konnten. Dieses Zielsystem hat übrigens den internen Namen: „Where’s Daddy?“. Das führt uns dahin zu sagen: Diese Art von Waffen, das sind Kriegsverbrechen.
netzpolitik.org: Staaten setzen solche Systeme bereits länger ein. Was ist an Systemen wie „Lavender“ neu?
Rainer Rehak: Die KI-Systeme, die jetzt zum Einsatz kommen, sind ein Nachfahre der sogenannten „Signature Strikes“. Dabei tötete man mutmaßlich militante Personen basierend auf Kommunikations-Metadaten. Das sind einfach gesagt Informationen dazu, wer, wo mit wem kommuniziert. Solche Daten spielten bei den Kampfeinsätzen des US-Militärs in Afghanistan eine maßgebliche Rolle.
Die Herangehensweise hat sich bis heute im Prinzip nicht geändert: Man toleriert Ungenauigkeiten einfach, vielleicht ist es durch KI sogar noch schlimmer geworden.
„Wenn etwas ans Licht kommt, werden nicht die bestraft, die die Systeme einsetzen“
netzpolitik.org: Automatisierte Systeme markieren die Ziele anhand der vorhandenen Daten. Dabei soll etwa bei „Lavender“ auch maschinelles Lernen zum Einsatz kommen. Gibt es Erkenntnisse dazu, welche Art und welche Menge von Daten benutzt wird?
Rainer Rehak: Soweit wir das wissen, werden etliche Kommunikationsdaten, Bewegungsdaten, Satellitendaten bis hin zu Kartendaten und Zahlungsdaten genutzt, derer man habhaft werden kann. Datenanalyse-Unternehmen wie Palantir Technologies Inc. helfen dabei. Die USA haben mit dieser informationsbasierten Zielanalyse damals nach dem Terrorangriff vom 11. September begonnen.
Gaza ist in der Hinsicht besonders, weil das ganze Umfeld direkt von Israel kontrolliert wird. Das heißt es geht auch um Informationen, wer oder welche Güter wann rein und wieder herausgehen.
Auch der Begriff des „gläsernen Gefechtsfelds“, den die Bundeswehr nutzt, verdeutlicht, wie alles Wissen, alle Daten verwendet werden sollen, um dann die Analysesysteme auf sie anzusetzen und zu sagen: Jetzt wollen wir mal errechnen, wer die Terroristen sind.
netzpolitik.org: Glaubst du, dass bei den Vereinten Nationen in der Diskussionen um autonome Waffensysteme noch etwas zu erreichen ist?
Rainer Rehak: Aktuell gibt es viel Widerstand, insbesondere von den Staaten, die an den Waffen arbeiten oder planen sie einzusetzen. Als China einmal gesagt hat, dass sie dafür seien, autonome Waffensysteme zu verbieten und eine Definition vorlegte, wäre darunter keins der Waffensysteme gefallen, über die wir jetzt reden. Das hilft bei der praktischen Umsetzung eines Verbots natürlich nicht weiter. Mein Eindruck ist daher, dass das länger dauern wird. Vielleicht mehr als zehn Jahre, vielleicht dauert es bis zu 20 oder dreißig Jahre. Das war bei den ABC-Waffen aber auch der Fall. Am Anfang wurde gesagt, das werden wir nie schaffen. Deshalb ist es aus meiner Sicht trotzdem wichtig, dass Deutschland und die EU mit anderen Partnerstaaten zusammen auf eine Ächtung als Kriegsverbrechen hinwirkt.
netzpolitik.org: Was muss passieren, damit der Einsatz von KI-basierten Waffensystemen in die Reihe der Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht aufgenommen wird?
„Was passiert, wenn wir uns dafür entscheiden diesen Weg weiterzugehen?“
Rainer Rehak: Wir brauchen eine viel größere Diskussion über die konkreten Systeme. Wir müssen anfangen die Faktenlage zusammenzutragen, so wie wir es mit unserem Papier versuchen. Erst dann können Leser:innen überhaupt merken, dass es kritikwürdig ist und dass wir noch gar nicht genug wissen. Ernstzunehmender Journalismus, der über diese Thematik auch technisch versiert berichtet, kommt bis heute eher selten vor. Außerdem sollten wir eine gesellschaftliche Debatte führen, die sich damit beschäftigt, wie sich Kriegsführung entwickelt. Eine Frage, die wir uns stellen: Was passiert, wenn wir als Welt uns dafür entscheiden, diesen Weg weiterzugehen?
netzpolitik.org: Gibt es etwas, das du den Leser:innen darüber hinaus noch gerne mitgeben würdest?
Rainer Rehak: Wir müssen uns daran erinnern, dass diese KI-Systeme immer ungenau sind. Wenn mal ein Fehler passiert und ich den falschen Film empfohlen bekomme oder ein Lied, das mir nicht gefällt, dann ist das nicht so problematisch. KI-Systeme für wirklich kritische Infrastruktur oder Waffensysteme einzusetzen, ist aber wahnsinnig.
Wie auch der kritische Informatiker Joseph Weizenbaum immer sagte: Da muss man der Versuchung widerstehen. Wir müssen eine innere Stärke aufbauen und uns die Frage stellen: Worum geht es eigentlich? Wollen wir Milliarden in diese Technik stecken oder lieber in langfristige Friedensbemühungen, in soziale Infrastrukturen.
Wir dürfen uns nicht von den Verheißungen über KI-basierte Systeme verzaubern lassen, insbesondere nicht von denjenigen, die sie gerne verkaufen oder nutzen möchten.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Vor kurzem fand die erste Digitalministerkonferenz statt. Aber was machen die Beteiligten eigentlich thematisch? Eine Textanalyse mit vielen Digitalisierungs-Bläschen. Eine davon: natürlich KI.

Üblicherweise kommt eine sonntägliche Ausgabe von Degitalisierung auf etwa 8.000 Zeichen. Diese Ausgabe ist das Destillat aus 13,7 Millionen Zeichen. Keine Sorge, muss keine*r ganz lesen. Der Auslöser dieser immensen Textmenge ist die DMK – die erste Digitalministerkonferenz.
Die Frage, ob es ein Digitalministerium überhaupt braucht, soll diese Kolumne ganz bewusst unbeantwortet lassen. Viel wird dazu meist vor Bundestagswahlen diskutiert, 2021 etwa: FDP braucht unbedingt ein Digitalministerium (März 2021). Nein, es brauche viele Digitalministerien, nicht nur eines, so etwa die Süddeutsche Zeitung (September 2017). Im Handelsblatt war man der Meinung, dass ein Digitalministerium als Übergangsministerium schon sinnvoll sein kann (Oktober 2021). Lilith Wittmann, selbsternannter schwarzer Block der Verwaltungsdigitalisierung, wollte das Digitalministerium im Oktober 2021 [€] gleich wieder abreißen.
Begrüßen, wollen, einladen
Diese Kolumne soll sich aber einer anderen Frage widmen: Was machen eigentlich die Beteiligten der Digitalministerkonferenz so thematisch? Gibt es da Besonderheiten? Gemeinsamkeiten? Oder alles ein heilloses Durcheinander?
In den Beschlüssen zur DMK heißt es etwa oftmals im Sprech politischer Diplomatie: Etwas wird anerkannt, wir laden den Bund ein (deshalb war Volker Wissing auch da), wir wollen, wir begrüßen, oder es wird ausdrücklich begrüßt, wenn es gerade ekstatisch klingen soll. Und am Ende wird vielleicht sogar wer anderes ganz energisch aufgefordert.
Diese gemäßigte und eher passive kommunikative Handlungsweise liegt freilich auch daran, dass es wie so häufig im Föderalismus sehr viele gibt, die mitreden wollen. Um zu wissen, worüber die DMK Teilnehmenden eigentlich so laut Selbstdarstellung reden, wurden für diese Kolumne entsprechend die Webseiten der Beteiligten analysiert. Welche Themen und Schlagworte kommen dort besonders häufig vor? Wie verhält sich das im Vergleich zu den anderen?
Eins vorweg: Die Analyse der Inhalte der für die Digitalisierungsthemen zuständigen Ministerien und anderen Teilen der jeweiligen Regierungen der Bundesländer ist erst einmal rein lexikalisch, also eine Schlagwortanalyse ohne vollständigen äußeren sprachlichen Sinnzusammenhang. Statistisch wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent präzise, aber als Tendenz durchaus aussagekräftig.
Die Rohdaten und das Vorgehen zur Analyse gibt es zur Transparenz im Repository bei codeberg.
Föderaler Flickenteppich
Zuständigkeiten im föderalen System sind oftmals ein Flickenteppich. Diese Verantwortungs- und Zuständigkeitsdiffusion macht ein fokussiertes Abarbeiten digitaler Baustellen oft schwierig. Im Digitalen gilt das besonders, wenn wir etwa einmal betrachten, wer für dieses Digitale je Bundesland oder im Bund zuständig sein soll. Der Bundestag schreibt in seinem Sachstand von Ende 2023 über Digitalministerien auf Bundes-, Landes- und internationaler Ebene, dass es eigentlich nur zwei echte Digitalministerien gibt: das in Bayern und seit Anfang 2024 in Hessen.
In den anderen Ländern ist der Themenbereichs Digitalisierung entweder der Staats-/Senatskanzlei oder einem bzw. mehreren Fachministerien zugeordnet.
Das ist natürlich auch auf Bundesebene so. Volker Wissing ist je nach verkehrs- oder digitalpolitischer Stau-Situation mal Digitalminister dem Namen nach, mal dann doch wieder Verkehrsminister.
Arbeit, Wirtschaft und viel Verkehr
In den Ländern werden die fachlichen Überordnungen dann durchaus bunt. Mal ist es das Innenministerium, mal die Landesregierung, mal das Wirtschaftsministerium, das sich für Digitalisierung zuständig fühlt. In Bremen wird die Zuständigkeit auf zwei Fachlichkeiten verteilt (Wirtschaft und Finanzen), Exoten wie Nordrhein-Westfalen weisen das Thema Digitalisierung dem Bauministerium zu und in Rheinland-Pfalz ist Digitalisierung eher Arbeit. In Sachsen-Anhalt ist Digitalisierung dem Namen nach zwar auch Infrastruktur, aber auch wieder eher Verkehr.
Männlich, Studium der Rechtswissenschaften, SPD, Jahrgang 1970
Die DMK besteht regulär aus 16 Personen, plus eine weitere Person mit Einladung des Verkehrsministers. Digitalisierung wird immer als Querschnittsaufgabe beschrieben, etwas, was nicht mehr aus der Gesellschaft wegzudenken sei. „Digitalisierung betrifft als Querschnittsthema nahezu alle Lebensbereiche“, heißt es auf der Webseite zur DMK etwa.
In der DMK darüber diskutieren zu können, ist statistisch gesehen aber wesentlich einfacher, wenn man über die folgenden Eigenschaften verfügt:
- männlich (71 Prozent)
- Studium der Rechtswissenschaften (44 Prozent)
- SPD-Mitglied (44 Prozent)
- Jahrgang 1970 (Mittelwert der Geburtsjahrgänge)
Volker Wissing ist als Verkehrs- und Digitalminister des Bundes mit einem Geburtsjahrgang 1970 und einem Studium der Rechtswissenschaften also so ziemlich der durchschnittliche Teilnehmer der DMK, von der Partei mal abgesehen.
Die dem Studium nach am ehesten zum Digitalen passende Ausbildung in der DMK hatte übrigens Wolfgang Tiefensee (Jahrgang 1955): Facharbeiter Nachrichtentechnik (Ausbildung), Fachingenieur für Informatik im Bauwesen (Studium) / Diplomingenieur Elektrotechnik (Studium). Gefolgt von Dr. Kristina Sinemus, Professorin für Public Affairs.
Danach wird’s sehr juristisch bis politikwissenschaftlich. Judith Gerlach, ehemalige bayerische Digitalministerin, sagte zwar einmal voller Überzeugung, dass sie als Juristin das mit der Digitalisierung ja auch noch irgendwie so einfach hinkriegen würde. Weil es ihr als Juristin ja leicht falle, sich „schnell und kompetent in neue und komplexe Themen einzuarbeiten“. Diese Aussage könnte wohl von vielen Beteiligten der DMK kommen.
Die Themen
Mit welchen Themen beschäftigen sich die Ministerien und weiteren Zuständigkeiten jetzt so überdurchschnittlich?
Es folgen ganz viele Bubble-Visualisierungen der einzelnen Bundesländer und des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, die jeweils aus den individuellen Text-Korpora gespeist werden.
Es werden jeweils nur die 25 oder 50 wichtigsten Begriffe visualisiert. Entfernt wurden zuvor Stopwörter, Füllwörter und Eigennamen. Für bestimmte Begriffe wie „Künstliche Intelligenz“ wurden entsprechend alle möglichen Ausprägungen, etwa KI, durch eine einheitliche Form ersetzt.
Baden-Württemberg
Das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg (Minister Thomas Strobl, CDU), spricht auf seinen Themenseiten Digitalisierung überdurchschnittlich häufig über Cybersicherheit.
Es verortet den Strategiedialog Automobilwirtschaft ebenso im Bereich Digitalisierung, weswegen die Wort-Bubble einen gewissen Automobilfokus aufweist.
Wohlgemerkt in einem Innenministerium.
Bayern
Das Bayerische Staatsministerium für Digitales (Minister Dr. Fabian Mehring, Freie Wähler) erwähnt auf seiner eigenen Webseite relativ häufig Bezeichnungen aus dem Cluster KI, aber auch als eines der wenigen Ministerien das Thema Blockchain (ansonsten nur im Kontext der Blockchainzeugnisse im Saarland).
Darüber hinaus gibt es quasi alles mit Bayern im Wording: BayCode, BayFid – Bayerns Frauen in Digitalberufen, byte als Digitalagentur Bayerns (sic!) und so weiter und so fort.
Das Scraping beinhaltet die Inhalte von zwei Legislatur-Perioden. Andere Webseiten haben hier eine klarere Trennung.
Berlin
In Berlin finden sind sich die Inhalte zum Thema Digitalisierung in den Bereichen der Senatskanzlei, federführend unter Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement, eigentlich politisch verortet in der bayerischen CSU (sic!).
Es gibt aber auch Inhalte der Berliner Smart-City-Strategie, die hier miterfasst wurden.
Überdurchschnittlich häufig dadurch vertreten die Themenfelder Open Data und Smart City – was aber bei anderen Stadtstaaten ähnlich ist.
Brandenburg
Im Land Brandenburg liegt das Thema Digitalisierung in der Staatskanzlei Brandenburg – Referat Digitale Gesellschaft unter Dr. Benjamin Grimm (SPD), Staatssekretär in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, Beauftragter für Medien und Digitalisierung.
Die Themen sind stärker fokussiert auf das Thema Digitale Verwaltung, im Besonderen auf die OZG-Leistungen Ein- und Auswanderung – Brandenburg hat dort die Federführung. Eine Webseite mit den seltsamsten URLs – test-detailseite-2-24 lässt grüßen.
Bremen
In der DMK für Bremen war Dr. Martin Hagen (Grüne), in Bremen beim Senator für Finanzen, die in Bremen für den Senat der Freien Hansestadt Bremen das Thema Digitalisierung mit begleiten (neben der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation).
Verwaltungsschwerpunkt, viel Onlinezugangsgesetz und das eher seltene Thema Vergabe, Beschaffung und e-Rechnung.
Hamburg
Der Stadtstaat Hamburg, vertreten durch die Senatskanzlei Hamburg in Person von Jan Pörksen (SPD, seit 2020), hat eigentlich nur eine Webseite zur Digitalisierung bei der Senatskanzlei selbst.
Hamburg bündelt seine digitalen Themen aber auch auf der Themenseite Hamburg digital. Dort geht es viel um Onlinedienste, Verwaltungsleistungen, Daten, Fachverfahren, aber auch viel um Modul F – Hamburgs Beitrag zur Digitalisierung der Verwaltung als Low-Code-Baukasten.
Hessen
Das zweite echte Digitalministerium ist das Hessische Ministerium für Digitalisierung und Innovation unter Ministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus (CDU, seit 2024).
Mischung aus Breitband- und Mobilfunkausbau, viel KI, aber auch digitalen Kompetenzen und Förderung der Digitalisierung des Ehrenamts.
Insgesamt die umfangreichste Webseite mit mehr als 4 Millionen Zeichen.
Mecklenburg-Vorpommern
Das Digitale hängt in Mecklenburg-Vorpommern im Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, geführt von Christian Pegel (SPD, seit 2021).
Besonders im Nordosten: Hier wird noch selbst mittels einer landeseigenen Funkmasteninfrastrukturgesellschaft das Land mit 5G versorgt.
Niedersachsen
In Niedersachsen liegt die Zuständigkeit für die Digitalthemen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung. An der DMK teilgenommen hat Staatssekretär Frank Doods (SPD, seit 2022).
Bemerkenswert in den Texten in Niedersachsen: hohe KI-Dichte (dichter als Digitalisierung).
Nordrhein-Westfalen
An der Wortwolke des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen lässt sich auch an den digitalen Themen ganz klar zeigen: Hier geht es ums Bauen, primär. Building Information Modeling, Digitales Bauen und so weiter.
Darüber hinaus einiges an E-Government und Onlinezugangsgesetz, allerdings generell auch eher wenig Content in Anbetracht auf die Bevölkerungsgröße.
Ministerin ist Ina Scharrenbach (CDU, seit 2022).
Rheinland-Pfalz
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz unter Führung von Alexander Schweitzer (SPD, seit 2021) ist thematisch eher als eine Mischung aus Verwaltungsdigitalisierung und Breitband- und Mobilfunkausbau zu sehen.
Besonders: relativ viele Themen mit Gigabit. Zumindest gibt es ein eigenes Gigabitkompetenzzentrum und eine Gigabitstrategie.
Saarland
Das Saarland, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie unter Jürgen Barke (SPD, seit 2022), zeigt einen Unternehmens- und Wirtschaftsfokus auch im Themenbereich Digitalisierung – wie von einem Wirtschaftsministerium zu erwarten.
Zusammen mit Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es hier noch am meisten Cybersicherheits-Themen.
Sachsen
In Sachsen ist formal eigentlich das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für Themen der Digitalisierung zuständig. An der DMK nahm Ines Fröhlich teil, Staatssekretärin für Digitalisierung und Mobilität (SPD, seit 2019).
Sachsen präsentiert die Inhalte zum Thema Digitalisierung auf einer eigenen Microsite – eine Mischung aus Digitalstrategie, Auflistung von Digitalpreisen und Fördermaßnahmen.
Daher zeigt die Bubble auch eher nur blumige Begrifflichkeiten mit diversen Handlungsfeldern.
Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt liegt das Thema Digitalisierung im Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt. Hausleitung dort ist Lydia Hüskens (FDP, seit 2021).
Thematisch geht es dort relativ viel um Netzausbau-Themen, WLAN und Verwaltungsleistungen, aber auch um Schulen ans Netz.
Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein ist der Chef der Staatskanzlei zugleich Digitalisierungsminister und damit für Digitalthemen zuständig. Damit hat Schleswig-Holstein mit Dirk Schrödter (CDU, seit 2022) quasi einen Digitalminister ohne Ministerium.
Thematisch ist Schleswig-Holstein eine Mischung aus KI-, Verwaltungs- und Wirtschaftsthemen. Besonders aber: In Schleswig-Holstein gibt es staatlich unterstützte Digitale Knotenpunkte zur Förderung der Verbreitung und Ausbreitung von digitalen Technologien als Bestandteil digitaler Partizipation. So eine Art staatliches Verzeichnis von Maker- oder Hackerspaces (inklusive Chaosspaces wie in Lübeck).
Thüringen
Thüringen geht mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft einen zumindest sprachlich etwas abweichenden Weg. Hier geht es viel um digitale Gesellschaft, weniger um bloße Digitalisierung. Minister ist Wolfgang Tiefensee (seit 2021, SPD).
Leider hat das Ministerium nur eine Seite zur Digitalen Gesellschaft online, weswegen noch der Thüringer Digitalmonitor Themen liefern musste. Darunter viel KI, aber auch Kultur und Museen. Auf jeden Fall zumindest inhaltlich etwas mehr gesellschaftlich orientiert.
Bundesministerium für Digitales und Verkehr
Im Hause Dr. Volker Wissings (FDP, seit 2021), dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, geht es im digitalen Bereich ganz klar um Daten, Daten, Daten und KI. Weit mehr als in allen anderen Digitalabteilungen auf Landesebene – zumindest lexikalisch gesehen. Und Verkehr und Mobilität. Und der Förderung dessen über den mFUND. Etwas 5G ist auch dabei, aber auch etwas Building Information Modeling.
Bemerkenswert: Über Digitalisierung, sonst das Universalwort bei allen anderen, wird weniger geschrieben im BMDV.
Sonstige Themen
- Open Source: Zumindest ansatzweise zu finden thematisch im Saarland und Schleswig-Holstein. Generell aber kaum genannt.
- Open Data: Der Themenkomplex kommt auf sehr vielen Seiten vor, wenn auch auf niedrigem Niveau. Besonders häufig in Berlin, dort aber auch wegen Nennung in der Smart-City-Strategie. Gar nicht vorgekommen ist das Thema im Saarland, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.
- Digitale Bildung: In Relation selten vorkommend, aber relativ häufig in Brandenburg.
- Digitale Kompetenzen: Generell politisch wertvoll und wichtig, thematisch aber selten genannt, aber relativ häufig in Sachsen, Brandenburg und Hessen.
- Autonomes Fahren: Begriffe um den Komplex autonomes Fahren werden in Relation in Baden-Württemberg häufiger genannt als im Bundesverkehrs- und Digitalministerium.
- KI: Wird auf quasi keiner Seite nicht genannt. Ist auf guten Wege, Digitalisierung als Buzzword abzulösen auf Ebene der Webseiten der Digitalministerien.
Alles zusammen
Hinweis: Durch den immensen Unterschied im Umfang der Webseiten von mehr als 4 Millionen Zeichen aus Hessen bis zu 33.813 in Rheinland-Pfalz ist diese Ansicht nur als grobe Tendenz zu sehen.
Angenommen, 17 Personen auf einer Digitalministerkonferenz bringen alle ihre Themen mit an den Tisch: Worüber würden sie sprechen? Digitalisierung, KI, Daten, Unternehmen, Verwaltung. Technisch vielleicht 5G und Breitbandausbau. Etwas Smart City. Das würde zumindest das Bild aller Inhalte der Teilnehmenden der DMK ergeben.
Am Ende wurde unter anderem gesprochen über:
- Nachhaltige IT bzw. Nachhaltigkeit durch IT und Smart City
- Digitale Teilhabe bzw. deren Aspekte im Kontext digitaler Verwaltungsleistungen (Digital first/only)
- Arbeitsbedingungen beim Breitbandausbau
- Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt
Alles nicht ganz überraschend, auch ganz ohne sich die Zukunft von einem Chatbot deuten lassen zu müssen.
Ob aus dieser Ansammlung von Personen und Themen jetzt eine wirkliche Beschleunigung der Digitalisierung folgt oder ob es nur eine weitere Sprechen-aber-nicht-Handeln-Runde zur Digitalisierung wird, bleibt zumindest spannend. Texte in Webseiten sind ja erst mal geduldig.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Ein Abschied und drei neue Projekte. Wir stellen euch im Schnelldurchlauf die wichtigsten Neuerungen der letzten Monate vor. Ein Ticker, eine Konferenz und unser neuer Doku-Podcast „Systemeinstellungen“.

Es war lange still bei unserem Off-the-Record-Podcast, aber das nicht ohne Grund: Seit Anfang des Jahres gab es einen großen Abschied und drei große Startschüsse. Markus Beckedahl hat netzpolitik.org nach fast 20 Jahren verlassen, wir haben einen Ticker gestartet, planen eine große Konferenz und außerdem ist gerade die erste Folge unseres Doku-Podcasts „Systemeinstellungen“ erschienen. Es werden sechs weitere Episoden folgen, jeden Freitag.
Wir nehmen euch mit auf einen kurzen Überblick zu unseren Baustellen, auf denen fleißig gewerkelt wurde und wird. Und da wir zu jeder eigentlich eine eigene Folge machen könnten, hören wir uns bald wieder!
In dieser Folge: Anna Biselli und Sebastian Meineck.
Produktion: Serafin Dinges.
Titelmusik: Trummerschlunk.
Hier ist die MP3 zum Download. Wie gewohnt gibt es den Podcast auch im offenen ogg-Format.
Unseren Podcast könnt ihr auf vielen Wegen hören. Der einfachste: in dem eingebundenen Player hier auf der Seite auf Play drücken. Ihr findet uns aber ebenso bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens, die URL lautet dann netzpolitik.org/podcast.
Wie immer freuen wir uns über Kritik, Lob und Ideen, entweder hier in den Kommentaren oder per Mail an podcast@netzpolitik.org.
Links und Infos
- Abschiedpost der Redaktion für Markus: Danke, Markus!
- Abschiedspost von Markus für die Redaktion: Danke, netzpolitik.org!
- Unser Ticker
- Unsere Konferenz „Bildet Netze!“ am 13. September
- Call for Participation für die Konferenz
- Unser neuer Podcast „Systemeinstellungen“
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Der Europäische Gerichtshof hat letzte Woche bei der anlasslosen Speicherung von IP-Adressen dem hohen Druck wieder etwas nachgegeben: Unter bestimmten Bedingungen ist eine anlasslose Speicherung möglich. Er tut seiner eigenen Autorität damit keinen Gefallen. Doch was heißt das Urteil für die deutsche Debatte um die Vorratsdatenspeicherung?

Als letzte Woche ein weiteres Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Frage der Vorratsdatenspeicherung verkündet wurde, war die Aufregung groß. EU-Staaten dürfen Providern nun eine Pflicht zur allgemeinen und unterschiedslosen Vorratsspeicherung von IP-Adressen auferlegen, wenn diese Speicherung keine genauen Schlüsse auf das Privatleben der betroffenen Person erlaubt.
Der Zugriff auf IP-Adressen ist seither auch weniger geschützt. Unter bestimmten Bedingungen ist bereits die Verfolgung von Filesharing über IP-Adressen möglich, um die es in dem französischen Hadopi-Fall ging. Die Behörde Hadopi spricht bei den ersten beiden Verstößen an Filesharer eine Warnung aus. Dafür muss Hadopi sie aber zuvor finden: Die französische Regierung erlaubt daher, die Identitätsdaten der Filesharer über deren IP-Adressen von Providern abzufragen.
Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat, lohnt sich ein weiteres Nachdenken über die Entscheidung, vor allem mit dem Blickwinkel auf die scheinbar unendliche deutsche Debatte um die anlasslose Massenüberwachung. Die Erosion der Rechtsprechung des EuGH war für viele Beobachter leider absehbar, auch wenn nicht wenige auf die Standfestigkeit in Fragen der Ablehnung einer verdachtslosen Telekommunikationsdatensammlung gehofft hatten.
Das absolut Notwendige
Matthias Bäcker, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Mainz und Prozessbevollmächtigter der SpaceNet AG, die mit einer EuGH-Entscheidung erfolgreich die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland stoppen konnte, bewertet die Entscheidung gelassen: Der EuGH hätte zwar nun „noch eine weitere Schippe draufgelegt“, da jetzt die Begrenzung auf schwere Kriminalität nicht mehr gelte, aber seit dem Jahr 2020 sei bereits ein Prozess des Zurückruderns zu beobachten gewesen.
Das EuGH-Urteil aus dem Jahr 2016 war das radikalste und erklärte eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung für unvereinbar mit dem Unionsrecht. Auch in den beiden EuGH-Urteilen des Jahres 2020 hielt das Gericht an seiner Linie fest, dass weiterhin für Telekommunikationsanbieter im Grundsatz die allgemeine und unterschiedslose Speicherungs- bzw. Weiterleitungspflicht von Verkehrs- und Standortdaten nicht mit dem Unionsrecht vereinbar sei. Denn ein solcher Eingriff in die entsprechenden Grundrechte beschränke sich eben nicht auf das absolut Notwendige.
Bei der Speicherung von IP-Adressen ließ der EuGH aber bereits 2020 Ausnahmen zu und bewertet sie als weniger intensive Grundrechtsbeeinträchtigung. Denn eine IP-Adresse ließe weniger Aufschluss darüber zu, wer mit einem Betroffenen kommuniziere, und sei als geringere Gefahr für eine umfassende Profilierung von Nutzerinnen und Nutzern anzusehen.
Doch der politische Druck ließ nicht nach, und beim Luxemburger Höchstgericht bröckelte die Abwehrfront. Denn es kamen auch nach dem Urteil weitere Versuche nationaler europäischer Gesetzgeber hinzu, um alle Kommunikationsdaten noch anlasslos festzuhalten, die vielleicht gerade noch möglich erscheinen. Letztlich hat der EuGH bei den IP-Adressen nun dem hohen Druck wieder etwas nachgegeben.
Eigentor für den EuGH
Bäcker beschreibt den nicht nachlassenden politischen Druck, den er auch als Prozessbevollmächtigter in Luxemburg deutlich verspürt habe. Die ergangenen EuGH-Urteile seien in Deutschland breit diskutiert worden, hätten in anderen Staaten der EU jedoch weit weniger Akzeptanz gefunden. Generell sei die Akzeptanz der EuGH-Urteile anderswo in Europa geringer als in Deutschland, das mit dem Bundesverfassungsgericht ein angesehenes Höchstgericht hat, dessen Vorgaben hohen Respekt genießen. Eine solche Institution fehlt in einigen EU-Staaten oder ihr wird in der gesellschaftlichen Debatte weniger Bedeutung eingeräumt. Damit verändert sich auch der politische Umgang mit EuGH-Urteilen. Die Mehrzahl der Regierungen der EU-Staaten wollen zudem mindestens die anlasslose Speicherung der IP-Adressen.
Das neue Urteil versucht, Begrenzungen einzubauen und vor allem einer Profilierung des Surfverhaltens vorzubeugen. Inhaltlich überzeugen können diese Begrenzungen den Juristen Bäcker indes nicht. Die Beschränkungen der Nutzung der IP-Adressen sei vielleicht für die Hadopi-Stufen möglich, aber sonst nur schwer vorstellbar. Etwa beim Zugriff in Strafverfahren wäre nicht klar, wie eine Profilierung der Betroffenen vermieden werden solle.
Doch welches problematische Signal setzt das Hohe Gericht, wenn es seine eigene Rechtsprechung in kleinen Schritten aufweicht? Da wäre einmal die Wirkung nach innen, also eine Botschaft an die EU-Staaten, dass ein jahrelanges Trommelfeuer gegen Grundrechte auch Erfolge nach sich zieht, dass rote Linien des Gerichts nicht wirklich rote Linien sind. Denn ein Zurückrudern hinter eigens festgeschriebene Grenzen ist das neue Urteil in jedem Fall, mögen sie auch weniger signifikant sein als zunächst befürchtet.
Das könnte zum Eigentor für den EuGH werden, der seine Autorität aus seinem kontinuierlichen Eintreten für die Grundrechte zieht. Für das Nicht-EU-Ausland, vor allem in Staaten, deren Menschenrechtslage problematisch ist, erscheint das Zurückweichen vor dem Überwachungsdruck und das schrittweise Zulassen anlassloser massenhafter Datenberge wie ein Menetekel: Wenn auch in der EU der Massenüberwachung immer weniger Einhalt geboten wird, macht das den Kampf anderswo auf der Welt nur noch schwerer.
Diesmal hat das Plenum aller Richter entschieden. Offensichtlich kam keine Einigung in der Großen Kammer zustande, so dass eine Plenarentscheidung her musste. An ihr dürfte nun allerdings eine Weile festgehalten werden, auch weil das aktuelle Urteil das letzte in absehbarer Zeit sein wird. Neue Entscheidungen stehen in Luxemburg erstmal nicht an.
Insofern bleibt ein Grund zur Freude für alle, denen die Grundrechte am Herzen liegen: Die Standortdaten und auch die Metadaten der Kommunikation bleiben vor anlassloser Massenüberwachung fürs Erste geschützt, Kontakt- und Bewegungsprofile aller Menschen anhand von Kommunikationsdaten soll es eigentlich in der EU nicht geben. Denn in der Frage, ob eine anlasslose Massenüberwachung der Kommunikationsdaten der gesamten Bevölkerung mit den Grundrechten vereinbar ist, hat sich nichts geändert, auch wenn einige EU-Staaten versuchen, die bestehenden EuGH-Urteile zu umgehen. Die Antwort auf die Frage lautet weiterhin im Grundsatz nein.
Vorratsdatenspeicherung in Deutschland nicht abgeschafft
Das Urteil könnte für die deutsche Debatte dennoch bedenkliche Folgen haben und die Streitigkeiten in der Ampel vertiefen. Wer hierzulande nicht mehr durchblickt: Der aktuelle Stand in der bundesdeutschen Debatte ist eine Art Stellungskrieg – keiner bewegt sich. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte zwar verkündet, dass sich die Bundesregierung auf das Quick-Freeze-Verfahren geeinigt hätte, das grundrechtsschonender ist. Für „Quick Freeze statt anlassloser Vorratsdatenspeicherung“ hätte der Minister „seit vielen Monaten gekämpft“ und sei nun erfolgreich gewesen.
Aber das scheint alles Ansichtssache. Denn auf den Fuß folgte eine Erklärung des SPD-geführten Innenministeriums (BMI), die eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen fordert, als hätte es Buschmanns Ankündigung der Einigung nie gegeben. Das BMI stellte seine Sicht dar: Die Einigung „beinhaltet ausdrücklich keine Vereinbarung darüber, ob und wie IP-Adressen künftig gespeichert werden“. Diese Frage werde explizit ausgeklammert. „Anders als der erste Entwurf des BMJ, der eine Abschaffung dieser Regelung vorsah, soll der künftige Entwurf, so wie wir die Verständigung innerhalb der Koalition verstehen, eine solche Regelung eben nicht beinhalten.“
Buschmanns Haus kündigte zwar an, einen aktualisierten Referentenentwurf zu Quick Freeze bald in die „Ressortabstimmung“ geben zu wollen. Doch seit Wochen herrscht nun wieder Stillstand.
Vorratsdatenspeicherung
Wir berichten seit zwanzig Jahren über die politischen Vorhaben rund um die Vorratsdatenspeicherung. Unterstütze unsere Arbeit!
Die derzeitige Fassung der Vorratsdatenspeicherung ist in Deutschland eben nicht abgeschafft und nie aus dem Gesetz gestrichen worden. Der Verband der Internetwirtschaft eco, der die SpaceNet AG beim Gang zum EuGH unterstützt hatte, forderte vor dem aktuellen Urteil im Zusammenhang mit der politischen Einigung auf das Quick-Freeze-Verfahren daher die konsequente Aufhebung der Vorratsdatenspeicherung.
Die SpaceNet AG hat ihren Fall zwar vor dem EuGH gewonnen, sie muss keine Telekommunikationsdaten ohne Anlass speichern, betont Bäcker. Auch für die Deutsche Telekom besteht keine Speicherpflicht. Es bleibt klargestellt, dass das deutsche Gesetz gegen EU-Recht verstößt.
Aber was ist mit anderen Providern? Könnte die Bundesnetzagentur nun eine Speicherung der IP-Adressen von anderen Providern wie etwa Vodafone verlangen? Dass nach dem aktuellen EuGH-Urteil das deutsche Gesetz anwendbar sein könnte, will Bäcker nicht ausschließen.
Umso dringlicher wird es, dass der Gesetzgeber nun Klarheit schafft. Da könnte der Koalitionsvertrag weiterhelfen, denn darin hat sich die Ampel darauf geeinigt, dass Daten nur „anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss“ gespeichert werden sollen.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Die 19. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 14 neue Texte mit insgesamt 119.887 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.
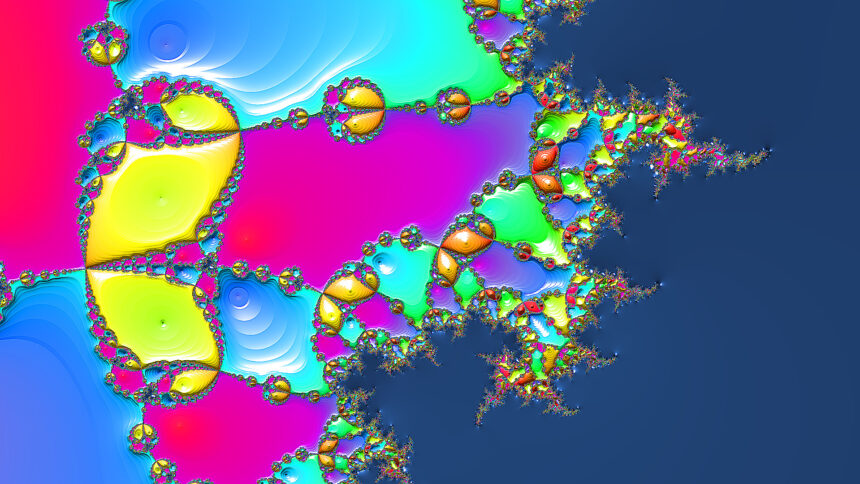
Liebe Leser*innen,
wir sind heute alle etwas aufgeregt. Vor allem Anna, Chris, Ingo, Serafin und ich. Na gut, in Wahrheit sind wir sogar SEHR aufgeregt. Denn heute haben wir etwas veröffentlicht, an dem wir eineinhalb Jahre lang gearbeitet haben. Unseren neuen Doku-Podcast „Systemeinstellungen“.
In dem Podcast erzählen wir die Geschichten von Menschen, die plötzlich ins Visier des Staates geraten: Hausdurchsuchung! Handy her!
Die erste Episode heißt „Link-Extremismus“ und ist – trotz der langen Vorarbeit – brandaktuell. Denn sie handelt von einem Journalisten, der jetzt gerade in Karlsruhe vor Gericht steht. Im drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Der Grund: Er hat in einer Nachrichtenmeldung eine Website verlinkt, die Website von Linksunten Indymedia. Und wenn ihr euch jetzt denkt: Hä bitte, was?! Ja, die Story ist genau so kurios, wie sie auf den ersten Blick scheint.
Der Doku-Podcast ist ein großes Ding für uns bei netzpolitik.org. In der Form haben wir so etwas noch nie zuvor gemacht. Zur Vorbereitung habe ich mir erst mal intensiv andere Doku-Podcasts angehört, weil ich wissen wollte: Wie haben die Geschichten erzählt? Warum gefallen mir einige Podcasts so gut, dass ich sie am liebsten mehrfach hören würde – und wie können wir selbst so etwas hinbekommen?
Ich glaube, das ist ein Grund, warum die Arbeit an „Systemeinstellungen“ so lange gedauert hat. Das war für uns keine Routine. Wir alle haben uns die Zeit genommen, einige Dinge das erste Mal zu machen. Und mehrfach zu überarbeiten, bis wir damit wirklich zufrieden sind.
Immer noch Schauer
In den letzten Wochen hat sich nochmal eine Menge getan. Anna, Chris, Ingo und ich haben im Akkord redigiert und Fakten gecheckt. Serafin hat immer wieder Schnittfassungen zum Probehören rausgehauen. Der ehemalige netzpolitik.org-Redakteur und Musiker Daniel Laufer hat uns eine Titelmusik komponiert. Und von unserer aktuellen Praktikatin und Kommunikations-Designerin Lea Binsfeld kommt das gelbgrüne Cover. Beim Joggen und Kochen und Wäsche-Aufhängen hatte ich immer wieder „Systemeinstellungen“ im Ohr – auf der Suche nach letzten Details, die man optimieren könnte.
Ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch! Einige Ereignisse, von denen wir erzählen, sind wirklich krass. Also: Die wühlen einen schon auf. Auch beim zehnten Hören bekomme ich an den entsprechenden Stellen ehrlich gesagt immer noch Schauer. Es ist halt die eine Sache, vor Überwachung und staatlicher Einschüchterung zu warnen und Gesetzentwürfe zu analysieren… aber eine völlig andere Sache, direkt mit betroffenen Menschen darüber zu sprechen und ihre Geschichten zu hören.
Schreibt uns gerne, wie ihr den Podcast findet, an podcast@netzpolitik.org. Und schickt den Podcast bitte auch an interessierte Freund*innen oder Familien-Mitglieder weiter!
Nächsten Freitag kommt dann die zweite von insgesamt sieben Folgen: Razzia im Pfarrhaus. Klingt wie eine Episode von „Die drei ???“, meinte eine Kollege. Ich bin mir sicher, da werden wir wieder aufgeregt sein.
Viel Freude beim Hören und schönes Wochenende
Sebastian
Italienische „Postkarten-Steuer“: Gemeinfreie Werke unter Gebührenzwang
Nach dem italienischen Kulturgüterschutzgesetz ist eine spezielle Verwaltungsabgabe zu zahlen, wenn historische Gebäude und Kunstwerke abgebildet werden. Ein Urteil des Stuttgarter Landgerichts hat den kuriosen Gebührenforderungen nun endlich Grenzen gesetzt. Und das Kulturministerium in Rom ergänzte die Vorschrift immerhin um Ausnahmen für die Wissenschaft. Von Lukas Mezger –
Artikel lesen
Neues aus dem Fernsehrat (105): ARD und ZDF präsentieren StreamingOS auf Open-Source-Basis
Die Zusammenführung der Entwicklung ihrer Mediathek-Software unter dem Titel „Streaming OS“ nutzen ARD und ZDF auch dazu, diese Open Source zu machen. Neben den üblichen Vorteilen von Freier und Open-Source-Software sind damit auch spezifische Vorteile für öffentlich-rechtliche Medien verbunden. Von Leonhard Dobusch –
Artikel lesen
Jetzt Trailer hören: Podcast „Systemeinstellungen“ erscheint ab 10. Mai
Hausdurchsuchung! Handy her! Was passiert mit Menschen, die unerwartet ins Visier des Staates geraten? In „Systemeinstellungen“ erzählen Betroffene, wie sich ihr Leben schlagartig verändert. Ein Podcast über Ohnmacht und erschüttertes Vertrauen. Von netzpolitik.org –
Artikel lesen
Hackbacks: Zurückhacken ist keine Verteidigung
Die Regierung hat sich im Koalitionsvertrag von Hackbacks klar distanziert, doch aus der CDU und von Ex-Geheimdienstlern kommt aktuell die Forderung nach digitaler Eskalation. Dabei verdreht Ex-BND-Chef Schindler die Tatsachen und stellt das Zurückhacken als Abwehr dar. Doch ein Hackback ist ein Gegenangriff und damit eine offensive Angriffsmaßnahme. Ein Kommentar. Von Constanze –
Artikel lesen
Biometrische Suchmaschine: Londoner Polizei soll tausendfach PimEyes aufgerufen haben
Auch in London darf die Polizei die umstrittene Gesichter-Suchmaschine PimEyes nicht nutzen. Dennoch sollen Beamt:innen die Seite mehr als 2.000 Mal aufgerufen haben. Jetzt hat die Behörde den Zugriff über Dienstgeräte gesperrt. Von Chris Köver –
Artikel lesen
Mobilitätsdatengesetz: Reisebuchung mit verschiedenen Verkehrsmitteln soll leichter werden
Reisen über Länder und Verkehrsmittel hinweg zu planen, ist heute immer noch sehr kompliziert. Das neue Mobilitätsdatengesetz soll Abhilfe schaffen und dazu führen, dass vom Fahrplan des lokalen Busunternehmens über den E-Roller bis zur Ladestation die Daten ausgetauscht und vernetzt werden können. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
OZG-Vermittlungsausschuss: Länder fordern mehr Einfluss und mehr Geld
Der Bundesrat hat das Onlinezugangsgesetz 2.0 im März abgelehnt. Eine Einigung soll nun der Vermittlungsausschuss bringen. Vor der ersten Sitzung Mitte Mai bekräftigen die Länder ihre Forderungen nach mehr Einfluss sowie nach einer stärkeren finanziellen Beteiligung des Bundes. Von Esther Menhard –
Artikel lesen
OpenAI: Neues Werkzeug soll KI-generierte Bilder erkennen
Ein neues Tool von OpenAI soll erkennen können, ob ein Bild echt ist oder mit dem Bildgenerator DALL-E erstellt wurde. Etwas ähnliches hat das gehypte Unternehmen bereits für seine KI-generierten Texte versprochen – und ist daran gescheitert. Von Chris Köver –
Artikel lesen
Urteil: EU-Parlament muss Abrechnungen von griechischem Neonazi-Abgeordneten herausgeben
Erstmals muss das Europäische Parlament Abrechnungsdaten eines Abgeordneten herausgeben. Weil Ioannis Lagos wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt wurde, überwiegt das öffentliche Interesse, urteilte das Gericht der Europäischen Union. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
Sea-Watch: Italien will Gegenüberwachung über dem Mittelmeer stoppen
2017 hat die EU-Kommission eine Hintertür für Pushbacks nach Libyen geschaffen. Im gleichen Jahr begann Sea-Watch die Beobachtung dieser Menschenrechtsverletzungen aus der Luft. Damit soll nun Schluss sein. Von Matthias Monroy –
Artikel lesen
Systemeinstellungen #1: Link-Extremismus
Aktuell muss sich ein Journalist in Karlsruhe vor Gericht verantworten. Ihm drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Der Grund: Er hat eine Website verlinkt. Episode #1 unseres Doku-Podcasts „Systemeinstellungen“ erzählt die erstaunliche Geschichte hinter dem Strafprozess. Von Serafin Dinges, Sebastian Meineck –
Artikel lesen
Informationsfreiheit: „Die Regierung selbst hat kein Interesse an Transparenz“
Wer das Informationsfreiheitsgesetz nutzen will, sollte bei der Plattform „Frag den Staat“ vorbeischauen. Wir sprechen mit Arne Semsrott über Aktivismus, nachhaltige Erfolge, Olaf Scholz’ Haltung zu Transparenz und wie Ministerien Kampagnen für mehr Informationsfreiheit gegen die Wand fahren ließen. Von Constanze –
Artikel lesen
Chatkontrolle: Belgien kurz vor Scheitern der Verhandlungen
Die EU-Staaten diskutieren, ob sie die Chatkontrolle auf Bilder und Videos beschränken wollen. Das hat die belgische Ratspräsidentschaft vorgeschlagen. Einige Staaten lehnen das jedoch ab. Die Verhandlungen sind seit Wochen festgefahren. Von Andre Meister –
Artikel lesen
Gesichtserkennung: BKA nutzte Fotos aus Fahndungsdatenbank für Software-Tests
Millionen Gesichtsbilder aus der zentralen INPOL-Datenbank stellte das Bundeskriminalamt zur Verfügung, um die Performance von mehreren Gesichtserkennungssystemen zu testen. Rechtsfachleute zweifeln an der Rechtmäßigkeit, ein mutmaßlich Betroffener überlegt zu klagen. Von Anna Biselli –
Artikel lesen
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Millionen Gesichtsbilder aus der zentralen INPOL-Datenbank stellte das Bundeskriminalamt zur Verfügung, um die Performance von mehreren Gesichtserkennungssystemen zu testen. Rechtsfachleute zweifeln an der Rechtmäßigkeit, ein mutmaßlich Betroffener überlegt zu klagen.

Mit Gesichtserkennungs-Software gleicht das Bundeskriminalamt beispielsweise Bilder von Überwachungskameras mit polizeilich bekannten Gesichtern ab, vor allem der sogenannten INPOL-Datei. 7.697 Suchläufe waren es im Jahr 2022, dabei wurden 2.853 zuvor unbekannte Personen identifziert.
Um verschiedene Software-Produkte zu vergleichen, ließ das BKA bis zum Jahr 2019 vom Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung mehrere Gesichtserkennungssysteme im Projekt EGES vergleichen – kurz für: Ertüchtigung des Gesichtserkennungssystem im BKA.
Recherchen des Bayerischen Rundfunks auf Basis von Informationsfreiheitsanfragen des CCC-Sprechers Matthias Marx haben nun ergeben, dass das BKA dem Institut dafür mehrere Millionen Gesichtsbilder von drei Millionen Personen zur Verfügung stellte. Sie stammten vor allem aus der zentralen INPOL-Datenbank.
Millionen von Gesichtern
Im Abschlussbericht des Projekts heißt es zum Datenbestand etwa:
Kopien von ca. 5 Millionen digitalen Bildern, die in INPOL-Z als frontale Gesichtsbilder von ca. 3 Millionen Personen markiert sind.
Dazu kamen Bilder von Freiwilligen, jedoch in weit geringerem Umfang, etwa „von 147 freiwilligen Testpersonen mindestens zwei digitale frontale Gesichtsbilder, die unter idealen Bedingungen über einen Zeitraum von etwas mehr als neun Jahren aufgenommen wurden“.
Aus einer weiteren Informationsfreiheitsanfrage zur diesbezüglichen Korrespondenz des Bundesdatenschutzbeauftragen mit dem BKA wird klar, dass den Beteiligten bewusst war, dass das Vorgehen rechtlich sensibel war.
Rechtsgrundlage mangelhaft
In einem Schreiben fragt ein Mitarbeiter des Bundesdatenschutzbeauftragten das BKA selbst nach der entsprechenden Rechtsgrundlage. Das wiederum beruft sich darauf, dass es keine Datenweitergabe gegeben habe und verweist auf ein kompliziertes System, bei dem etwa ein Rechner ohne Verbindung zum Internet und ohne externe Schnittstellen zum Einsatz kam. Nach Projektende seien alle Festplatten physisch zerstört worden.
Das BKA berief sich unter anderem auf einen Paragrafen im BKA-Gesetz, der die Nutzung der Daten für Forschungszwecke erlaubt. Ganz überzeugt hat das den Bundesdatenschutzbeauftragten offenbar nicht, er sieht in dem Vergleich von kommerziellen Produkten keine Forschung. „Es mangelt an einer Rechtsgrundlage“, heißt es in einem Schreiben. Beanstanden wollte er das Projekt aber nicht, wegen der komplexen rechtlichen Situation. Nach monatelangem Austausch mit dem BKA heißt es von Seiten des Datenschutzbeauftragten: „Eine Einigung konnte indes nicht erzielt werden.“
Der vom BR befragte Rechtswissenschaftler Mark Zöller ist ebenfalls skeptisch. Die Sicherheitsbehörde müsse sich an das BKA-Gesetz halten. Und das regele nicht, welche Daten für Software-Tests genutzt werden dürfen.
Janik Besendorf, dessen Bild mutmaßlich auch für die Tests genutzt worden waren, hat nun Beschwerde beim Bundesdatenschutzbeauftragen eingereicht. Er war erkennungsdienstlich behandelt worden. Das zugehörige Verfahren wurde zwar eingestellt, er geht aber davon aus, in der Datensammlung gelandet zu sein. Der IT-Sicherheitsexperte überlegt außerdem, in der Sache gegen das BKA zu klagen.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Die EU-Staaten diskutieren, ob sie die Chatkontrolle auf Bilder und Videos beschränken wollen. Das hat die belgische Ratspräsidentschaft vorgeschlagen. Einige Staaten lehnen das jedoch ab. Die Verhandlungen sind seit Wochen festgefahren.

Die EU-Staaten haben am Mittwoch in der Arbeitsgruppe Strafverfolgung wieder über die Chatkontrolle verhandelt. Dort waren die Verhandlungen nach fast zwei Jahren zuletzt festgefahren.
Im Gegensatz zu bisherigen Sitzungen hat die belgische Ratspräsidentschaft vorher keinen neuen Textvorschlag erarbeitet und verschickt. Stattdessen hat die Ratspräsidentschaft mündlich ein neues Konzept vorgestellt.
Laut einem Sprecher des Rats schlägt Belgien vor, die Chatkontrolle auf visuelle Inhalte zu beschränken, also auf Bilder und Videos. Audio- und Textinhalte sollen demnach nicht mehr gescannt werden.
Außerdem schlägt die Präsidentschaft „eine Upload-Moderation mit Zustimmung der Nutzer“ vor, so der Sprecher weiter: „Wenn die Genehmigung erteilt wird, kann Bildmaterial hochgeladen werden, das dann mit einer speziellen, überprüften Software aufgespürt werden kann.“
Keine Einigung in Sicht
Da die EU-Staaten den Vorschlag nicht vorher prüfen konnten und es noch keine schriftliche Version gibt, haben sie unter Vorbehalt diskutiert. Einige Staaten lehnen eine Einschränkung der Chatkontrolle auf Bilder und Videos jedoch ab, sie wollen sämtliche Inhalte scannen.
Andere Staaten lehnen es ab, neben bekannter strafbarer Kinderpornografie auch nach unbekannten Inhalten und Grooming zu suchen. Vor allem die Niederlande kritisieren diesen Punkt in jeder einzelnen Verhandlungsrunde. Einige Staaten fragten, „wie sich die Upload-Moderation mit dem Aspekt Verschlüsselung verhält“.
Zwar fordern die meisten Staaten weiterhin, bald eine Einigung zu finden. Die grundsätzlichen Probleme der Chatkontrolle sind aber weiterhin ungelöst. Daher gibt es unter den Staaten weiterhin keine ausreichende Mehrheit, das Gesetz zu beschließen.
Die belgische Ratspräsidentschaft hat nicht gesagt, wie es weitergehen soll. Laut Kalender finden die nächsten beiden Verhandlungsrunden erst im Juni statt, während und kurz nach der EU-Wahl.
Damit ist es mittlerweile ziemlich unwahrscheinlich, dass Belgien noch eine Einigung der EU-Staaten herbeiführen kann. Anfang Juli übernimmt Ungarn die Ratspräsidentschaft.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Wer das Informationsfreiheitsgesetz nutzen will, sollte bei der Plattform „Frag den Staat“ vorbeischauen. Wir sprechen mit Arne Semsrott über Aktivismus, nachhaltige Erfolge, Olaf Scholz’ Haltung zu Transparenz und wie Ministerien Kampagnen für mehr Informationsfreiheit gegen die Wand fahren ließen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es nun das Transparenzportal „Frag den Staat“, und von Anfang an ist Arne Semsrott dabei. Die Website erlaubt es, Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) bequem von der Couch aus loszutreten, sozusagen Klicktivismus für mehr Transparenz – aber mit Anspruch, guter Benutzerführung und zumindest Erfolgsaussicht.
Elisa Lindinger, Elina Eickstädt und Constanze Kurz – das Team des Podcasts „Dicke Bretter“ – sprechen mit Arne Semsrott darüber, was sich in Sachen Transparenz verändert hat, seit Wolfgang Schmidt und Olaf Scholz das Bundeskanzleramt besiedelt haben. Seine Einschätzungen stellen der Ampel-Regierung kein gutes Zeugnis aus. Was ist die Bilanz bei den Verwaltungsgerichten, die in vielen Fällen angerufen werden müssen? Und wie wird es mit „Frag den Staat“ weitergehen?
Arne Semsrott ist Politikwissenschaftler und Aktivist für mehr Transparenz und arbeitet seit zehn Jahren bei der Informationsfreiheitsplattform Frag den Staat. Er engagiert sich auch beim Freiheitsfonds, einem Projekt, bei dem Menschen aus dem Gefängnis freigekauft werden und politisch für eine Entkriminalisierung des Fahrens ohne Ticket geworben wird. Mehrere Jahre hat er auch bei netzpolitik.org über Informationsfreiheit und Transparenz geschrieben.
Sein neues Buch heißt Machtübernahme – Was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren. Eine Anleitung zum Widerstand und wird am 3. Juni erscheinen.
Zwischen allen Stühlen

Elina Eickstädt: Lieber Arne, was ist Informationsfreiheit?
Arne Semsrott: Informationsfreiheit ist das Recht auf Zugang zu Information. Es ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht, das wir alle haben. Das ist in Deutschland und in anderen Ländern über Gesetze geregelt, die uns die Möglichkeit bieten, alle möglichen Informationen vom Staat zu holen. Es geht also um alles, was in Aktenschränken liegt und dort teilweise verkümmert. Das können wir besorgen oder wir können zumindest versuchen, es zu besorgen. Und das ist häufig ein ganz schöner Kampf.
Elina Eickstädt: Wo würdest du das Konzept von „Frag den Staat“ als Plattform für Personen, die aktivistisch tätig werden wollen, einordnen? Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz als Aktivismusmittel einzusetzen, ist ja eine neue Idee gewesen.
Arne Semsrott: Ich sehe „Frag den Staat“ als Organisation zwischen allen Stühlen: Sie ist ein mögliches Mittel für Aktivistinnen und für Organisationen, um Druck zu machen, sich Infos zu holen, sich bemerkbar zu machen und Kampagnen oder Vorhaben, die sie haben, zu verstärken.
Es gibt ja diese Informationsfreiheitsgesetze. Über die haben wir die Möglichkeit, Infos vom Staat zu bekommen. Dann ist aber die Frage: Wie kann man das in politischer Arbeit so einsetzen, dass es tatsächlich einen Unterschied macht?
Das offensichtlichste Beispiel: Ich hole mir eine Information, da steht irgendwas Krasses drin. Ein Referat im Innenministerium streitet sich zum Beispiel mit einem Referat im Justizministerium. Ich kriege das mit, weil ich alle E-Mails zwischen den beiden Häusern abfrage. Wenn ich das an die Öffentlichkeit gebe, kann ich vielleicht in einem Gesetzgebungsprozess Druck machen.
Aber es funktioniert auch ein bisschen subtiler. Wenn ich eine spezifische Anfrage stelle, gerade in laufenden Prozessen, dann merken die Behörden das und werden vielleicht achtgeben, was überhaupt in eine Akte reingeschrieben wird. Das heißt, das kann Prozesse ändern durch das Wissen, dass da jemand draufschaut.
Es gibt zudem zahlreiche Ausnahmetatbestände in Informationsfreiheitsgesetzen, sie sind überhaupt verbesserungswürdig. Aber auch wenn ich eine Ablehnung einer Anfrage bekommen, kann ich das für Kampagnen gut nutzen, denn ich kann dann sagen: Seht mal, die haben diesen Gesetzgebungsprozess, aber die geben die Infos nicht raus. Offensichtlich haben die was zu verbergen. Und man kann natürlich auch mit geschwärzten Akten gutes Campaigning machen. Es ist teilweise so, dass Infos, die sie nicht rausrücken, interessanter sind als Infos, die sie rausrücken.
Datenbestände freikriegen
Elisa Lindinger: Ich erinnere mich noch an meine erste IFG-Anfrage über „Frag den Staat“: Das war in der Kampagne „Topf Secret“. Das wäre ein drittes Beispiel, wie die Plattform wirkt: Da geht es weniger darum, eine parteipolitische Agenda zu haben oder quasi hoch aufgehängte Themen zu besetzen, sondern stärker darum, einen Datenbestand freizukriegen, der bisher nicht einsehbar war. Konkret ging es um die Gutachten von Gesundheitsämtern zu Restaurants, in die wir alle gern gehen und essen und vielleicht ganz gern wissen wollen würden, wie es in deren Küche aussieht. Solche Kampagnen habt ihr früher relativ oft gemacht und gefühlt wird das jetzt weniger. Täusche ich mich da?
Arne Semsrott: Nein, das stimmt. Bei „Topf Secret“ geht es um Lebensmittelkontrollberichte und ich glaube, was wir mit dieser Kampagne geschafft haben, ist das Zusammenfassen egoistischer Motive von einzelnen Leuten zu einer Kampagne mit einem höheren Ziel. Ich gehe beispielsweise in ein Restaurant, dann habe ich einen verdorbenen Magen. Dann will ich erstmal sehen: War das Hygieneamt eigentlich da? Vielleicht haben sie ja Hygieneprobleme gefunden.
Es haben jetzt etwa 60.000 Leute Lebensmittelkontrollberichte über die Plattform angefragt – aus ihren eigenen Motiven. Das zusammengenommen ergibt dann eine Kampagne für mehr Transparenz in dem Bereich. Denn wir können natürlich sehr gut sagen: Offensichtlich wollen so viele Leute das wissen, dann wäre es doch viel einfacher, diese Infos von sich aus zu veröffentlichen. Das war immer die Forderung, die wir mitkommuniziert haben.
Interviews
Wir kommen gern ins Gespräch. Unterstütze unsere Arbeit!
Constanze Kurz: Die Kontrollberichte hängen oft auf Papier in den Ämtern, aber sie veröffentlichen sie nicht online.
Arne Semsrott: Ja, es kommt aber auf die Bundesländer an, die machen es unterschiedlich. Das Ziel, was man eigentlich haben will, ist ein bundesweites Gesetz, vielleicht ein Smiley-System, das draußen am Restaurant angebracht werden muss. Das wäre viel leichter für alle.
Man müsste dafür einen Prozess etablieren. Das ist natürlich schwierig, denn Prozesse etablieren ist immer eine große Pein. Letztlich haben die Verwaltungen und das Landwirtschaftsministerium gesagt: Nein, dann ballern sie uns halt mit tausenden Anträgen zu, das müssen jetzt die Ämter alle abarbeiten.
Wir können aber nun zu den einzelnen Ämtern hingehen und sagen: Macht doch bitte Druck beim Bundesministerium, damit sie Gesetze einführen, dann habt ihr diese Arbeit nicht mehr. Das heißt, man kann über einen klaren, letztlich ökonomischen Druck bei den Behörden dafür sorgen, dass die dann wiederum aus Eigeninteresse für eine Sache lobbyieren.
Komplett gegen die Wand fahren
Constanze Kurz: Wir beobachten die Projekte von „Frag den Staat“ schon länger und sind selber auch Nutzer der Plattform. Es gibt mittlerweile einen klaren „Pushback“, also Gegendruck für das Ansinnen nach mehr Informationsfreiheit. Aktuell gab es etwa ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das als ein Rückschritt bewertet werden kann. Hast du angesichts dieser Entwicklung noch dieselben aktivistischen Energien, sind sie sogar eher mehr oder strukturierter geworden? Wie siehst du deinen Aktivismus nach einem Jahrzehnt?
Arne Semsrott: Ich glaube, es hat sich ein bisschen verlagert. Ich bin auf jeden Fall deutlich pessimistischer in allem. Das ist gar nicht unbedingt schlimm, das macht die Arbeit vielleicht tatsächlich eher besser. Manchmal ist natürlich ein naives Herangehen super, weil man denkt, man kann es schaffen. Wenn einem vorher klar wäre, was für eine Arbeit das ist, dann würde man vielleicht gar nicht erst anfangen. Insofern ist Naivität auch immer ganz schön.
Aber gerade bei diesen Kampagnen, die Elisa ansprach, sind es deswegen weniger geworden, weil wir mit der letzten Kampagne, die wir gemacht hatten, ganz schön auf die Schnauze gefallen sind. Das war „gläserne Gesetze“, eine Kampagne, mit der wir die Bundesverwaltung zwingen wollten, all ihre Lobbykontakte offenzulegen. Es war riesig angelegt, letztlich 10.000 Anfragen nach einzelnen Lobbytreffen.
Die Bundesministerien haben uns komplett gegen die Wand fahren lassen. Sie haben sie alle abgelehnt. Wir haben viel geklagt dagegen und sind letztlich nach drei Jahren vor den Verwaltungsgerichten angekommen.
Diese Prozesse sind wahnsinnig lang. Das heißt, da war dann die Luft raus aus dieser Kampagne. Nach drei Jahren kannst du nicht so eine Spannung aufrechterhalten. Dann hat die Bundesverwaltung vor dem Verwaltungsgericht einen ziemlich großen Sieg für sich errungen. Sie konnten nämlich gut nachweisen, dass die Informationen nach Lobbytreffen, also beispielsweise wann sich eine Bundesministerin mit einem Chemieverband getroffen hat, in der Bundesverwaltung nicht strukturiert vorliegen, weil deren Aktensysteme einfach sehr schlecht sind.
Das heißt: Wenn sich die Verwaltung intern misslich organisiert, dann sagen die Verwaltungsgerichte, dass es dann nicht rausgegeben werden kann. Das heißt auch: Diese komplett verkorkste Digitalisierung führt dazu, dass man einfach an Infos nicht rankommt. Und dann fällt so eine Kampagne auch auf die Nase.
Elisa Lindinger: Ihr kämpft ja bei „Frag den Staat“ für die Grundlagen, nämlich Transparenz. Diese Transparenz ist in sich wenig wert, aber sie ermöglicht einen Kampf für Gerechtigkeit, für Einflussnahme, für mehr Mitwirkung, für Verantwortlichkeit. Da haben wir noch einen langen Weg zu gehen, ein wirklich dickes Brett zu bohren.
Arne Semsrott: Ja, und wir haben eine Regierung, die selbst kein Interesse daran hat. Da sind die Grünen hervorzuheben, weil sie als Opposition immer für Transparenz gekämpft haben, auch aus Eigeninteresse, weil die Opposition kaum an Infos rangekommen ist. Jetzt sind sie an der Regierung, haben Zugriff auf die Infos und bringen keinen großen Druck dahinter, diesen ganzen Prozess transparenter zu machen.
Constanze Kurz: Wie bewertest du die Ampel-Regierung, nachdem über die Hälfte der Legislaturperiode nun vorbei ist?
Arne Semsrott: Die Grünen haben wirklich tolle kleine Anfragen gemacht, als sie in der Opposition waren. Sie haben viele Infos an die Öffentlichkeit geholt, gerade auch im NSA-BND-Komplex. Die Leute, die daran im Bundestag gearbeitet haben, arbeiten da immer noch dran. Aber sie stellen keine kleinen Anfragen mehr, sondern sie stellen interne Anfragen an die Bundesregierung. Das läuft jetzt alles im Koalitionsausschuss. Intern kriegen sie die Antworten genauso wie vorher, aber sie werden alle nicht mehr veröffentlicht.
Das heißt: Die Öffentlichkeit ist einfach außen vor, und das stört die Grünen offensichtlich nicht besonders. Mein Eindruck ist: Die Grünen sind wahnsinnig loyal zu dieser Ampel, die geben kaum Infos raus. Leute, mit denen man vorher ordentlich reden konnte, die reden einfach nicht mehr mit einem.
Was Transparenz angeht, gibt es einfach überhaupt keine Veränderung zur vorherigen Regierung. Wenn, dann ist es sogar teilweise schlechter geworden. Denn jetzt ist der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, der für Olaf Scholz seit zwanzig Jahren sozusagen die Leichen im Keller begräbt. Stichwort wäre beispielsweise der Steuerraub, der durch die Cum-Ex-Files öffentlich wurde. Beim Thema Transparenz ist Schmidt ein gebranntes Kind.
Wir haben beispielsweise eine Klage am Laufen zum Sondervermögen Bundeswehr. Das sind diese 100 Milliarden Euro, die kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine beschlossen wurden. Dazu gibt es offiziell drei Dokumente im Kanzleramt, für so eine Entscheidung, in ein paar Tagen 100 Milliarden Euro freizumachen. Drei Dokumente!
Natürlich haben sie viel ausführlicher darüber gesprochen, aber alles wurde nicht mehr veraktet. Auch in diesem Fall sagt dann das Verwaltungsgericht: Wenn sie Infos nicht gibt, dann können wir auch nichts machen. Und damit kommt dann ein Wolfgang Schmidt und ein Olaf Scholz durch. Das hat Merkel vorher sicher auch gemacht. Aber ich habe den Eindruck, dass es jetzt einfach noch krasser geworden ist.
Constanze Kurz: Es ist ja bekanntes Phänomen, auch in der Merkel-Regierungszeit wurde das kritisiert. Die Frage ist, ob es ein strategisches Prinzip ist. Es betrifft ja nicht nur das Kanzleramt, sondern auch die Ministerien. Was wird überhaupt veraktet? Ihr hattet auch juristische Kämpfe um die Fragen nach SMS- und Messenger-Nachrichten. Es ist ja auch eine Realität, dass die Menschen in der jetzigen Regierung zehn Jahre jünger sind als in der Regierung von Merkel davor. Sie benutzen Smartphones anders. Ganz offenkundig verakten sie weniger. Es ist richtig, dass ihr juristisch hier wenig erreicht habt?
Arne Semsrott: Total. Im Gegenteil würde ich sogar sagen, wir haben ein paar wichtige juristische Sachen verloren, die eine schlechte Praxis dann auch noch legalisiert haben.
SMS-Nachrichten sind ein Beispiel. Konkret hatten wir eine Klage gegen das Auswärtige Amt. Es ging um SMS, jetzt aktuell zur Ukraine und davor vom ehemaligen Minister Heiko Maas zu Afghanistan. Da saßen dann die Beamten im Verwaltungsgericht und haben gesagt: Schauen Sie, technisch ist das gar nicht möglich, mit diesen Geräten SMS zu senden, offensichtlich ist das also nicht passiert. Dann fragt das Verwaltungsgericht: Was ist denn mit eurer internen Anweisung? Dann holen die Beamten die interne Anweisung raus, da steht drin: Man darf keine SMS verschicken. Dann sagen alle: Eine deutsche Verwaltung arbeitet nach Recht und Gesetz.
Und das war’s. Jetzt kommt man an die SMS nicht ran, weil es sie offiziell nicht gibt. Dass alles per SMS gemacht wird oder per Threema oder mit anderen Messengern, das ist klar, auch in einem kleinen Gerichtssaal. Das heißt: Das einzige, was da noch bleibt, sind Leaks.
Die Zukunft von „Frag den Staat“
Elina Eickstädt: Wie verändert sich die Strategie von „Frag den Staat“ angesichts solcher Urteile und Praktiken?
Arne Semsrott: Wir sind nicht mehr nur die Informationsfreiheitsgesetz-Organisation. Die IFG-Anfragen sind inzwischen ein Baustein innerhalb eines Ökosystems von verschiedenen Methoden.
Ich selbst widme mich auch Sachen, die ein bisschen weiter entfernt sind vom Informationsfreiheitsgesetz. Es läuft jetzt gerade ein Strafverfahren gegen mich wegen der Veröffentlichung von Dokumenten in Bezug auf die „Letzte Generation“. Die Dokumente stammen aus laufenden Strafverfahren. Das eine Straftat und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden.
Das hat natürlich mit dem Informationsfreiheitsgesetz nichts mehr zu tun, aber immer mit dem breiten Komplex des Zugangs zu Informationen. Es ist in dem Fall ein strategisches Mittel, sich verklagen lassen und zu schauen, was ein Strafverfahren an Klärung bringen kann. Im Idealfall führt dieses Verfahren dazu, dass die zugrundeliegende Norm im Strafgesetzbuch für verfassungswidrig erklärt wird. Was aber auf jeden Fall schon passiert ist: Wir haben eine Fachdiskussion. Die Strafnorm im Strafgesetzbuch ist Grütze, da sind sich schon mal alle einig.
Arne Semsrott von FragDenStaat angeklagt wegen Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten
Constanze Kurz: Ein anderer Baustein von dem, was du gerade als Ökosystem beschrieben hast, ist das öffentliche Berichten. Ihr schreibt im Blog anders, nämlich deutlich journalistischer. Ihr schreibt trotzdem immer noch wertend. Ihr bemüht euch nicht, aufgesetzt sachlich zu klingen, sondern man merkt, wenn ihr eine Entscheidung falsch oder eine politische Richtung nicht korrekt findet. Ihr drückt das deutlich aus. Ihr wirkt dabei dennoch auf eine starke Weise professionalisiert. Hängt das an den Menschen, die neu dazukamen, oder ist das absichtlicher Teil der Weiterentwicklung der Plattform?
Arne Semsrott: Wir haben viel gelernt von netzpolitik.org.
Constanze Kurz: Ihr macht auch viele Medien-Kooperationen, richtig?
Arne Semsrott: Wir versuchen tatsächlich alles, was wir machen, immer als Kooperation mit anderen Medien zu machen. Das hat zwei Wirkungen. Das eine ist, dass wir versuchen, die anderen Medien damit zu infiltrieren, also mit unserer Art zu arbeiten. Das funktioniert auch ziemlich gut. Nach einer Recherche, wenn sie denn gut war, stellen sie vielleicht selbst IFG-Anfragen und wollen selbst ähnlich transparent arbeiten, wie sie es vorher mit uns gemacht haben. Das andere ist, dass wir natürlich eine Reichweite in Zielgruppen bekommen, die wir sonst nicht bekommen. In der netzpolitischen Bubble sind wir stark, das kommt aus der Geschichte von „Frag den Staat“. Aber in andere Communitys zu kommen, wo man vielleicht vom Informationsfreiheitsgesetz und von „Frag den Staat“ noch nichts gehört hat, das versuchen wir über solche Kooperationen.
Das gleiche gilt auch für unsere Kampagnen. Das versuchen wir immer mit anderen NGOs zusammen zu machen oder mit anderen sozialen Bewegungen, um einfach andere Gruppen zu erreichen und nicht nur in unserem eigenen Saft zu schmoren.
Ich meine, dass so eine Professionalisierung auch einfach mit einer gewissen Größe kommt. Wir sind jetzt zwanzig Leute, das ist schon eine ganze Menge. Dadurch können wir auch eine größere Breite an Themen bespielen.
Abertausende Anfragen
Constanze Kurz: Sag mal ein paar Zahlen. Wieviele Leute engagieren sich auf der Plattform? Wieviele IFG-Anfragen und wieviele Antworten gibt es? Wieviele positive Antworten sind darunter?
Arne Semsrott: Über „Frag den Staat“ sind in den letzten zwölf, dreizehn Jahren 260.000 Anfragen von knapp 120.000 Usern gestellt worden. Wir haben natürlich ein paar Power-User, aber in der Regel stellen die Leute zwei, drei Anfragen. Vieles hat einen persönlichen Bezug: Die Leute haben Interesse an einer Verkehrskreuzung oder einer Kita, die neu gebaut wird. Viele Anfragen sind erfolgreich, tatsächlich die meisten. Denn die meisten sind gar nicht brisant, sondern verlaufen im Kommunalen und bringen den Leuten auch wirklich, was sie wissen wollen.
Was man öffentlich mitbekommt, sind natürlich die brisanten Fälle. Da ist ohnehin klar, dass die Verwaltung etwas nicht rausgeben will. Ein Beispiel ist die Anfrage zur Bundeswehr und den 100 Milliarden Euro. Wenn ich so eine Anfrage stelle, weiß vorher schon: Das geht vor Gericht, das geben die nicht freiwillig raus. Bei diesen brisanten Fällen muss man in der Regel klagen.
Wir gewinnen auch die meisten Fälle vor Gericht. Eine häufige Konstellation ist auch, dass wir klagen und die Behörde dann merkt: Okay, er meint es ernst, dann geben sie die Akten raus. Es braucht dann gar nicht erst eine Verhandlung. Die meisten Sachen in erster Instanz, also beim Verwaltungsgericht, gewinnen wir.
Die ganz großen Fälle, die du vorher angesprochen hattest, also etwa um die SMS-Nachrichten und solche großen strategischen Fälle, wo wir durch alle Instanzen gehen und die dann in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht landen, die verlieren wir fast alle. Da sitzen aber auch die konservativsten Richter.
Constanze Kurz: Hast du nicht im Blog sogar ultrakonservativ geschrieben?
Arne Semsrott: Man kann ja mal den Präsidenten vom Bundesverwaltungsgericht in eine Suchmaschine eingeben und sich anschauen, in was für einer Burschenschaft er ist. Und das kann man mit anderen Richtern dort auch machen. Es ist tatsächlich gerade dieser zehnte Senat des Bundesverwaltungsgerichts, der Präsidenten-Senat, der zuständig für Informationsfreiheit ist. Der hat sich vor kurzem noch ein paar Zuständigkeiten dazugeholt.
Es gab in diesem Informationsfreiheitsbereich lange die Konstellation, dass der zehnte Senat, der zuständig war, immer sehr konservativ geurteilt hat: immer alles gegen die Informationsfreiheit. Aber der sechste Senat hat in Informationsfreiheitsachen sehr progressiv geurteilt hatte. Der sechste Senat war für den BND zuständig, er war damit auch zuständig für Presse- und Informationsfreiheit im BND-Kontext. Findige Journalistinnen haben, wenn sie eine Sache geklärt haben wollten, gegen den BND geklagt. Hier bist du in erster Instanz beim Bundesverwaltungsgericht, denn die niederen Verwaltungsgerichte dürfen nicht an den BND ran.
Wenn man also gegen den BND klagt, ist man direkt in Leipzig. Wenn man irgendeine Konstellation geklärt haben wollte, hat man also gegen den BND geklagt und ist dann beim progressiven sechsten Senat nicht beim konservativen zehnten Senat gelandet. Im Vergleich zum zehnten urteilte der sechste Senat oft so, dass mehr rausgegeben werden musste. Das hat den zweiten Senat so gestört, dass sie sich jetzt die Presse- und Informationsfreiheit in BND-Sachen rübergeholt hat. Das heißt auch: Die BND-Klage, die wir am 7. November verhandelt wird, kommt dann vor den zehnten Senat, also vor den Präsidenten-Senat. Wir gehen davon aus, dass die alles zurückdrehen, was vorher geurteilt wurde.
Nachhaltige Erfolge
Elina Eickstädt: Mich sprechen oft Menschen an, weil ich viel politische Arbeit machen. Sie fragen: Was können wir eigentlich machen? Was ist die Einstiegsdroge für politische Arbeit aus deiner Sicht?
Arne Semsrott: Tatsächlich glaube ich, IFG-Anfragen zu stellen, das mal auszuprobieren und so Kontakt zur Staatsmacht aufzubauen, ist eine gute Übung, um ein bisschen die Angst davor zu verlieren. Das habe ich an mir gemerkt: Am Anfang war ich unsicher im Umgang mit Behörden. Es kommen als Antwort Briefe in gelben Umschlägen, die man sonst nur kennt, wenn man was zahlen muss oder was falsch gemacht hat. Aber zu merken, ich hab ein Recht denen gegenüber und das kann ich versuchen durchzusetzen, das ist eine ganz gute Übung. Ich glaube, dass IFG-Anfragen tatsächlich eine gute Einstiegsdroge sein können in ein politisches Engagement.
Constanze Kurz: Ich muss dir noch eine Frage stellen: Rückblickend auf die letzten zehn Jahre, worauf bist du im Nachhinein wirklich stolz, was war ein besonders nachhaltiger Erfolg?
Arne Semsrott: Es gibt ein paar Praktiken, die jetzt ganz normal geworden sind: Inzwischen ist es total normal, dass die Bundesministerien die Referentenentwürfe, also die ursprünglichen Entwürfe von Gesetzen, veröffentlichen. Das war 150 Jahre lang nicht so.
Das ist ja ein deutsches Spezifikum: In Deutschland macht ein Ministerium diesen Referentenentwurf. Er war lange nicht online zu finden, bis wir dazu eine Kampagne gemacht hatten. Das ist tatsächlich wichtig, um den Gesetzgebungsprozess besser nachvollziehen zu können. Der demokratische Prozess ist jetzt transparenter.
Aber ich würde als zweites Beispiel auch sagen: Vor drei Jahren ist Franziska Giffey als Bundesministerin zurückgetreten. Ehemals nannte sie sich Dr. Franziska Giffey, jetzt nur noch Franziska Giffey. Sie ist zurückgetreten als Bundesministerin, weil herausgekommen ist, dass sie plagiiert hat. Und dass es rausgekommen ist, liegt an einer IFG-Anfrage.
Elina Eickstädt: Vielleicht enden wir auf dieser positiven Note: Man kann unliebsame Politikerinnen auch mit IFG-Anfragen loswerden. Vielen Dank für das Gespräch, Arne!
Das Gespräch ist eine gekürzte Version des Podcasts „Dicke Bretter“. Er erscheint beim Chaosradio.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Aktuell muss sich ein Journalist in Karlsruhe vor Gericht verantworten. Ihm drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Der Grund: Er hat eine Website verlinkt. Episode #1 unseres Doku-Podcasts „Systemeinstellungen“ erzählt die erstaunliche Geschichte hinter dem Strafprozess.

Alles beginnt mit einer unscheinbaren Nachrichtenmeldung im Internet. Sechs Sätze über ein eingestelltes Ermittlungsverfahren, hat man schnell überflogen. Monate später klingelt die Polizei beim Journalisten Fabian Kienert: Hausdurchsuchung!
Es ist früh am Morgen, Fabian völlig verschlafen. Der Journalist glaubt, da will bloß irgendjemand Stress machen. Er ruft: „Haut ab!“. Aber die Leute gehen nicht weg, sie hämmern sogar an seine Tür. Plötzlich begreift Fabian: Da draußen im Treppenhaus, da steht gerade die Polizei.
„Link-Extremismus“ ist die erste Episode unseres neuen Doku-Podcasts Systemeinstellungen – wenn der Staat bei dir einbricht.
Sie erzählt die Geschichte eines Journalisten von Radio Dreyeckland, der sich aktuell vor Gericht verantworten muss. Der Grund: In seinem Online-Artikel hat er einen Link auf das Archiv von linksunten.indymedia.org gesetzt. Das ist ein früheres Portal der linken und linksradikalen Szene. Im Jahr 2017 wurde es verboten.
Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat Fabian mit dem Link eine verbotene Vereinigung unterstützt. Dafür drohen laut Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.
Kann es sein, dass ein Journalist wegen eines Links in den Knast muss?
Genieße den Podcast wo und wie es Dir gefällt:
- hier auf der Seite im eingebetteten Player oder per RSS-Feed
- zum Download als MP3 oder im offenen ogg-Format
- im Podcatcher Deines Vertrauens mit der URL netzpolitik.org/systemeinstellungen
- bei Apple Podcasts oder Spotify oder Deezer
- sowie zum Nachlesen als Manuskript hier auf der Seite oder im WebVTT-Format.
Hier findest Du alle Folgen von „Systemeinstellungen“. Die nächste Episode „Razzia im Pfarrhaus“ erscheint am 17. Mai.
Host und Produktion: Serafin Dinges.
Redaktion: Anna Biselli, Chris Köver, Ingo Dachwitz, Sebastian Meineck.
Cover-Design: Lea Binsfeld.
Titelmusik: Daniel Laufer.
Weitere Musik von Blue Dot Sessions.
Links und Infos
- 18. April 2024: Bericht zum Prozessauftakt am Landgericht Karslruhe
- Übersicht: Hausdurchsuchungen gegen Radio Dreyeckland
- Soliwelle Dreyeckland: Prozessberichte
- Deine Spende für digitale Freiheitsrechte
Manuskript zum Nachlesen
Serafin Dinges: Wir sind nach Süddeutschland gereist, genauer gesagt nach Freiburg im Breisgau, in die Universitätsstadt mit Aussicht auf den Schwarzwald. Was ihr da rattern hört, das ist mein treuer pinker Rollkoffer. Der kommt in fast jeder Folge vor, wenn ich ihn durch eine neue Stadt ziehe. Jetzt gerade ziehe ich ihn also durch Freiburg, durch einen Innenhof, ein paar Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. An den Wänden wächst Blauregen, eine wunderschöne, üppige Kletterpflanze. Hätte ich nicht erkannt. Aber das hat Sebastian für mich rausgefunden. Der interessiert sich nicht nur für die Namen von Pflanzen, sondern ist auch Redakteur bei netzpolitik.org und heute dabei. Hier im Innenhof, da gibt es selbstverwaltete Wohnprojekte, ein Café mit dem Motto „chaotisch, sonnig, links“ – und die Redaktion von Radio Dreyeckland. In den Regalen, da stapeln sich Kassetten und CDs aus Jahrzehnten. Die Schränke, Tische und Türen, die sind beklebt mit Plakaten und Stickern.
Stimme: Gegen Macker und Sexisten // Fight the power, fight the cis-tem // Nazis aufmischen
Serafin Dinges: Radio Dreyeckland, ich glaube, das kann man schon sagen, das ist ein bisschen ein linker Laden. Das freie Radio sendet seit 1977, und die meisten, die hier arbeiten, machen das ehrenamtlich. Freie Radios, das sind kleine, nicht-kommerzielle Radiosender. Die verwalten sich meistens basisdemokratisch, und es gibt eine ganze Szene davon. Radio Dreyeckland hier in Freiburg berichtet über Klimapolitik, über Rassismus, über Musik, über Filme. Es gibt auch Sendungen, die sind auf Englisch, Türkisch oder Persisch. Wir sind hier, um eine der wenigen Personen zu treffen, die bei Radio Dreyeckland auch ein bisschen Geld verdienen. Wir treffen Fabian.
Fabian Kienert: Ich bin Fabian Kienert, freier Journalist und auch schon sehr, sehr lange Redakteur bei Radio Dreyeckland.
Serafin Dinges: Ein schmaler Typ mit leicht zerzausten Haaren. Man könnte ihn so auf Mitte 30 schätzen. Und man kann ihn sich ganz gut in einer WG-Küche bei einer politischen Diskussion vorstellen. Fabian kommt super nachdenklich rüber. Man hat das Gefühl, beim Sprechen prüft er noch mal jedes Wort, ob es wirklich genau so stimmt.
Fabian Kienert: Und bin auch seit mehreren Jahren hier bei Radio Dreyeckland für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sehr lange Jahre viel in der aktuellen Redaktion von Radio Dreyeckland.
Serafin Dinges: Fabian, der schreibt also schon länger recht unbeschwert Texte für die Website von Radio Dreyeckland. Auch noch bei Radio Dreyeckland ist Andreas.
Andreas Reimann: Mein Name ist Andreas Reimann und seit 2018 bin ich Geschäftsführer von Radio Dreyeckland und auch Verantwortlicher im Sinne des Presserechts der Website von Radio Dreyeckland.
Serafin Dinges: Verantwortlich im Sinne des Presserechts. Das heißt, Andreas ist der Typ im Impressum. Der Mensch, bei dem man sich zuerst beschweren kann, wenn irgendwas auf der Website komisch aussieht. Andreas ist Mitte 50 und schon seit 1991 bei Radio Dreyeckland, also quasi schon immer. In unserem Gespräch bezeichnet er sich mal als Büroklammer.
Andreas Reimann: … wie so eine ganz langweilige Büroklammer an Schreibtisch setzen kann.
Serafin Dinges: Andreas, so bekommen wir schnell das Gefühl, das ist ein Typ mit Erfahrung. Jemand, auf den man sich verlassen kann.
Andreas Reimann: Ja, ich bin wahrscheinlich so ein relativ geduldiger Mensch, der auch dann eben in so was wie eine Finanzverwaltung reinpasst.
Serafin Dinges: Aber zurück in die Redaktionsräume. Bei unserem Besuch im August, da ist es im Radio Dreyeckland recht verträumt. Durchs Fenster sieht man den sonnigen Hof. Im Radio läuft eine aufgezeichnete Sendung. Es ist Siesta-Stimmung. Im Winter dagegen, ein paar Monate davor, war es hier recht – na ja – unentspannt.
Stimme im Radio: Ich weiß nicht, wie eure Berichterstattung gerade ist oder ob ihr schon die Hörerinnen davon informiert haben, die Zuhörenden, was da gerade in zwei Wohnungen in Freiburg stattfindet.
Serafin Dinges: Denn was sich hier in dieser verträumten Redaktion und bei Fabian und Andreas zu Hause abspielt, das ist nicht weniger als ein Kampf um die Pressefreiheit.
Die Meike: Die Polizei ist im Haus und in zwei Privaträumen. Ich wusste aber…
Fabian Kienert: … doch gemeint ist, ja es scheint wirklich irgendwie die Polizei zu sein…
Andreas Reimann: … da hab ich natürlich schon so vor Augen, dass die Wohnung danach aussieht wie nach einem Erdbeben. Aufgerissene Schubladen, zerwühlte Schränke…
Stimme im Radio: … das ist ein unsäglicher Vorgang, den sich diese Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt Graulich leistet.
Stimme auf einer Demo: Es ist Blamage für die Demokratie! Pressefreiheit! Pressefreiheit! Pressefreiheit in Deutschland. Ich fordere Pressefreiheit…
Serafin Dinges: Ich bin Serafin Dinges, und ihr hört die erste Folge von Systemeinstellungen. Ein neuer Podcast von netzpolitik.org. In diesem Podcast treffen wir Menschen, bei denen plötzlich die Polizei auf der Matte steht. Ohne Einladung. Und dann dringen die Polizistinnen ein, in die Wohnung, in die Handys, in die Privatsphäre. Die Polizei darf das, aber sie darf es nicht immer. Und manchmal darf sie, aber sollte vielleicht nicht. Wir fragen uns: Wann ist die Gewalt vom Staat selbst ein Vertrauensbruch oder ein Rechtsbruch? Heute Folge 1: Link-Extremismus.
Akt 1: Eine schnöde Meldung
Serafin Dinges: Unsere Geschichte beginnt im Juli 2022. Da schreibt der Redakteur Fabian eine Meldung für die Website von Radio Dreyeckland. Die Meldung ist super kurz. Ein Titel, sechs Sätze. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingestellt. Paragraf 170 Absatz zwei…würde ich wahrscheinlich einfach rüberscrollen. Für Fabian Routine.
Fabian Kienert: Ja, das war auf jeden Fall stinknormaler Tag jetzt. Nichts. Nichts Besonderes.
Serafin Dinges: Immerhin schreibt er seit rund 15 Jahren für das Radio. Und am Ende packt er noch sein Kürzel drunter: FK, Fabian Kienert. Was Fabian nicht ahnt: Bald werden Menschen in ganz Deutschland über seinen Artikel sprechen. Menschen in Freiburg werden auf die Straße gehen und protestieren. Aber erstmal… Passiert nichts. Der Sommer vergeht, und irgendwann im Herbst findet Fabian in seinem Briefkasten einen Brief, der ihn verwirrt.
Fabian Kienert: Der Absender: Polizeidirektion Freiburg. Da denkt man sich natürlich schon: Hä, um was geht’s jetzt?
Serafin Dinges: Die Polizei Freiburg schreibt: Gegen Fabian wird ermittelt. Er soll doch mal vorbeikommen. Und nicht nur Fabian. Auch der Geschäftsführer Andreas hat Post von der Polizei im Briefkasten. Und auch er soll vorbeikommen.
Andreas Reimann: Ich war wirklich verwundert, weil ich nicht nachvollziehen konnte, um was es geht. Es war in diesem Schreiben überhaupt nicht erklärt begründet, was der Vorwurf ist. Es war nur der Hinweis, es läuft ein Ermittlungsverfahren, weil ich gegen einen Paragraphen verstoßen habe.
Serafin Dinges: Es ist der Herbst 2022 und Andreas und Fabian wissen nicht, was ihnen blüht. Na ja, sie haben zumindest einen Verdacht. In dem Brief schreibt die Polizei vom Vereinsgesetz. Und darum ging es auch in der Meldung, die Fabian im Juli geschrieben hat. Darin steht: die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen einen angeblichen Verein eingestellt. Genauer gesagt gegen Linksunten Indymedia. Linksunten Indymedia, das war mal ein sehr wichtiges Portal für die linke und linksradikale Szene. Alle die wollten, dürften dort posten. Teilweise gab es dort auch linksradikale Bekennerschreiben.
Stimme: Letzte Nacht ist eine dreckige Bullenkarre in Connewitz in Flammen aufgegangen… daher haben wir in der letzten Nacht bei der Bullenwache für Glasbruch bei drei Fenstern gesorgt… Ganz Wien hasst die Polizei, scheiß Bullenschweine!
Serafin Dinges: Auf Linksunten gab es aber auch jede Menge harmlose Berichte, Recherchen, Lesetipps über Antifa Treffen, Aktionen, Demos, sowas halt.
Stimme: Hilfe für Hamburger, Obdachlose, Stellplatz gesucht… Linksradikale Demo in Düsseldorf verläuft friedlich… Straßenmusik gegen AfD-Wahlkampf in Augsburg.
Serafin Dinges: Den Ermittlungsbehörden aber war Linksunten Indymedia lange ein Dorn im Auge. 2017 kam es dann zum Knall. Statt gegen einzelne Posts vorzugehen, die vielleicht Gesetze verletzen, hat das Bundesinnenministerium mal eben das gesamte Portal verboten.
Tagesschau-Sprecher: … eine einflussreiche Internetplattform der linksextremen Szene verboten, die linksunten.indymedia.org.
Serafin Dinges: Ein ganzes Messageboard, eine Website also einfach verboten.
Tagesschau-Sprecher: … den drei Betreibern der Seite wurde heute in Freiburg die Verbotsverfügung zugestellt.
Serafin Dinges: Das ist für deutsche Verhältnisse schon krass. Und ob das rechtlich auch wirklich okay war, daran zweifeln Bürgerrechtler:innen bis heute. Nach dem Verbot gab es noch jahrelange Ermittlungen zu den Menschen hinter Linksunten Indymedia. Im Visier: Verdächtige aus Freiburg. Radio Dreyeckland hat dazu immer wieder kritisch berichtet. Klar, ist ja auch das linke Radio in Freiburg. Als die Ermittlungen dann 2022 endlich eingestellt wurden, schreibt Fabian eine Meldung zum Ende dieser nicht enden wollenden Geschichte. Er schreibt – genau – die eine Meldung, von der wir vorhin gesprochen haben. Der Titel, den Fabian wählt: Linke Medienarbeit ist nicht kriminell. Und jetzt, im Herbst ’22, hat Fabian also diesen Brief von der Polizei in der Hand. Den Brief, den auch Andreas bekommen hat und in dem steht: Gegen sie wird ermittelt. Und beide vermuten, das war wohl diese eine Meldung über Linksunten, die der Polizei nicht geschmeckt hat.
Andreas Reimann: Das war eine reine Mutmaßung. Und wir haben dann überlegt… oder ehrlich gesagt haben wir nicht lange überlegt. Die Entscheidung war eigentlich relativ schnell klar, dass wir zu diesem Termin nicht gehen werden, weil das ist der Staatsschutz in Freiburg, und wir haben eigentlich keine Veranlassung gesehen, jetzt mit dem Staatsschutz über das, was wir auf unseren Kanälen, im Programm oder auf der Webseite veröffentlichen, zu sprechen.
Serafin Dinges: Andreas und Fabian ignorieren den Brief von der Polizei ,und erst mal passiert auch nichts. Scheinbar. Der Herbst geht. Die Tage werden kürzer, der Winter kommt. Fabian erinnert sich.
Fabian Kienert: Da bin ich vielleicht nachträglich naiv davon ausgegangen, dass sich das schon im Sande verläuft. Es gibt ja auch immer mal wieder Ermittlungsverfahren, wo man entweder gar nichts hört oder irgendwann hört, dass es eingestellt wurde. Das fand ich so absurd, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie jetzt irgendwas weiter da vonstattengeht.
Serafin Dinges: Was Fabian währenddessen nicht ahnt: Die Polizei ermittelt weiter, und sie wird sich ein zweites Mal melden. Dieses Mal aber nicht mehr per Post.
Akt 2: Ein langer Tag im Januar
Serafin Dinges: Es ist der 17. Januar 2023. Freiburg. 6:30 Uhr morgens. Es ist noch dunkel. Die Temperatur knapp über Null. Ein Mehrfamilienhaus mitten in Freiburg. Fabian Kienert schläft.
Fabian Kienert: Ich wurde, ich glaube gegen 6:45 Uhr geweckt. Vielleicht war es auch 6:40 Uhr. Von einem Sturmklingeln. Da habe ich fest geschlafen und habe erst mal eigentlich so das irgendwie als nerviges Geräusch wahrgenommen. Hab ein bisschen gebraucht, bis ich dann auch wirklich aufgestanden bin und nachgeguckt habe. Und dann habe ich halt gemerkt, dass da welche an der Tür sich zu schaffen machen. Und das löst dann natürlich schon eine gewisse Panik aus. Hab dann erst mal einfach irgendwie ängstlich, so ein bisschen: „Haut ab!“ gerufen. Erstmal wusste ich nicht, was es ist. Habe erstmal wirklich einfach gedacht: Boa, irgendjemand versucht sich da irgendwie Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Aber hab einfach erst mal einen Einbruch gedacht. Aber was natürlich, wenn man da irgendwie völlig völlig verschlafen ist, schon einfach eine totale Überforderung ist…
Serafin Dinges: Fabian ist völlig perplex und glaubt, da ist jemand im Treppenhaus und will bei ihm einbrechen.
Fabian Kienert: Dann irgendwann total starkes Klopfen, wurde ich dann halt mit Namen angesprochen. Kriminalpolizei und so. Auch da hab ich erst mal noch gedacht, dass… hä?… das kann nicht sein. Es ist irgendwie ein Trick. Und dann wurde aber auch noch mal gesagt: Hier, Durchsuchungsbeschluss. Und irgendwann hab ich dann doch gemerkt, es scheint wirklich irgendwie die Polizei zu sein, die jetzt hier Durchsuchungsbeschluss hat.
Serafin Dinges: Fabian macht die Tür auf und bekommt irgendwas vor die Nase gehalten. Einen Durchsuchungsbeschluss. Da steht, warum die Polizei jetzt seine Wohnung durchsuchen will. Und plötzlich ergibt alles Sinn. Der komische Brief im Herbst. Der Artikel im Sommer. Linksunten Indymedia. Hat alles dazu geführt, dass die Polizei jetzt hier vor seiner Tür steht.
Fabian Kienert: Dann habe ich den gleich so überflogen und gesagt: Was, ihr seid wegen dieser Meldung hier? Ist das euer Ernst?
Serafin Dinges: Die Polizei meint es ernst und Fabian erinnert sich, wie die Beamt:innen anfangen, sich langsam in der Wohnung zu verteilen. Ungefragt.
Fabian Kienert: Ja, ich habe schon praktisch zum Ausdruck gebracht, dass ich will, dass sie nur in dem Zimmer, wo ich auch bin, ihre Durchsuchungsmaßnahmen machen. Aber da muss man schon sagen das.. da haben sich dann einzelne von denen jetzt auch nicht immer dran gehalten. Also da sind dann schon Schubladen aufgegangen, wo ich nicht direkt dabei war, wo ich das dann irgendwie rascheln gehört habe.
Serafin Dinges: Acht Beamtinnen will Fabian gezählt haben, teilweise in Zivil, teilweise mit Polizeiwesten. Und die fangen jetzt an seine Wohnung zu filzen.
Fabian Kienert: Sie haben jetzt bei mir nicht jeden Kleiderschrank ausgeräumt, sondern sich schon so auf die Umgebung des Schreibtischs praktisch hauptsächlich beschränkt. Mit Ausnahme, also es wurden auch andere Schubladen geöffnet. Aber jetzt natürlich trotzdem sind da viele Unterlagen, die sie da irgendwie kreuz und quer… Und einfach viel Papier, viel Bücher, die sie dann halt aus dem Regal holen, die dann alle irgendwie durcheinander liegen…
Serafin Dinges: Aber Moment, wir können uns jetzt mal einen Luxus, den Fabian damals nicht hat und halten einen Moment inne. Wir müssen uns nämlich fragen, was hier eigentlich gerade passiert. Fabian steht da im Schlafanzug in seiner Wohnung und Beamt:innen durchblättern seine Bücher. Aber was wollen die denn genau mit Fabians Büchern? Und was genau haben diese Bücher mit seinem Artikel über Linksunten Indymedia zu tun? Die Beamt:innen sind nämlich da, um rauszufinden, wer genau die Nachrichtenmeldung über Linksunten Indymedia verfasst hat. So erklären sie es Fabian. Wenn ihr auch nur mit einem halben Ohr zugehört habt, dann wisst ihr schon, wer die Meldung geschrieben hat: Fabian hat die Meldung geschriebe. Und ja, das wusste die Polizei zu diesem Zeitpunkt auch. Hinter der Meldung steht ja das Kürzel „FK“. Und das steht für Fabian Kienert. Und in den polizeilichen Akten stand auch schon Wochen vor dieser Razzia: Bei dem Redakteur mit dem Kürzel FK handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Fabian Kienert. Sogar während der Razzia sagt Fabian immer wieder deutlich: Ich war das. Ich, ich hab den geschrieben.
Fabian Kienert: … ist jetzt nicht genau der anwältliche Rat, immer sowas gleich das einzuräumen. Aber ich habe gerade gleich auch einem Polizisten dort gesagt: Ja, den habe ich geschrieben. Klar, da sehe ich auch kein Problem in diesem Artikel. Das habe ich schon gleich eingeräumt, dass ich diesen Artikel verfasst habe. Aber die Durchsuchung ging trotzdem dort erst mal bei mir weiter.
Serafin Dinges: Trotzdem bestehen die Beamt:innen darauf, seine Wohnung zu durchsuchen für irgendeinen Beweis, dass er diesen Artikel geschrieben hat. Und Fabian erlebt in diesem Moment: Wenn so eine Razzia mal in Gang gesetzt wurde, dann lässt sich die nicht mehr stoppen. Die Beamt:innen haben den Durchsuchungsbeschluss für Fabians Wohnung. Also durchsuchen sie die Wohnung. Fabians Laptop stecken sie in eine Tüte. Immerhin könnte mit dem Laptop ja die Meldung über Linksunten Indymedia verfasst worden sein. Und weil Passwörter für Laptops gerne auf Zetteln stehen, filzen die Beamt:innen auch Fabians Papiere. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, die sich eine besonders eifrige Behörde stellen könnte. Nämlich: Hat Fabian diese Meldung auch wirklich ganz alleine verfasst?
Serafin Dinges: Freiburg. Gleicher Tag. Gleiche Uhrzeit. 17. Januar ’23. Halb sieben Uhr morgens. Es ist noch dunkel. Die Temperatur knapp über null. Ein freundliches Wohngebiet mit Reihenhausgärten und gestutzten Hecken. Andreas Reimann schläft.
Andreas Reimann: Ich habe irgendwann läuten gehört. Offenbar erst das dritte oder vierte Läuten. Wie ich dann später der Akte entnommen habe, hat die Polizei mit so einem leicht säuerlichen Unterton in die Akte reingeschrieben, sie mussten mehrfach läuten.
Serafin Dinges: Irgendwas ist da los. Unterm Vordach, am Eingang zum Reihenhaus. Aufgeregt nimmt Andreas die Treppen runter ins Erdgeschoss.
Andreas Reimann: Und dann habe ich die Tür aufgemacht. Und dann sehe ich, dass da relativ viele Leute stehen. Zum Teil in Uniform, zum Teil in Zivil. Und mir wurde dann sofort ein größerer DIN-A4-Kram entgegengehalten. Also ein Papier mit dem Hinweis, dass jetzt hier eine Hausdurchsuchung stattzufinden hat.
Serafin Dinges: Die Polizei fragt Andreas, wer noch in der Wohnung ist. Und Andreas sagt: Oben im Schlafzimmer, da ist seine Frau.
Andreas Reimann: Dann wurde ich gebeten, dass ich da zu meiner Frau hoch gehe, ins ins Schlafzimmer. Die dann ziemlich erschrocken ist. Die hat viel erschrockener reagiert, war dann auch aus dem Schlaf gerissen und hat mir auch danach erzählt. Sie hat das Gefühl, plötzlich war das Schlafzimmer voll mit Polizei. Obwohl es, glaube ich, nur so zwei drei Leute waren.
Serafin Dinges: Wenig später findet sich Andreas unten in der Küche wieder. Die Beamt:innen haben ihm einen Haufen Papiere vorgelegt. Im Haus werden Schubladen geöffnet und irgendwo im Haus hört er seine Frau. Ihm gegenüber ist der Staatsanwalt Manuel Graulich.
Andreas Reimann: Und der Herr Graulich hat dann versucht, erst mal mir zu sagen, um was es geht, und hat zum einen den Durchsuchungsbefehl für die Privatwohnung überreicht. Das war dann gleich so ein Bündel von ich glaube, ich habe es noch mal kurz überschlagen, von 30 Seiten oder so was. Also das war jetzt nicht einfach nur so ein Formular. Also es war ein richtig dickes Papier, und er bat mich auch das durchzulesen. Und ich saß zu dem Zeitpunkt noch barfuß in unserer Küche. Also das war schwierig, mich da zu konzentrieren und überhaupt irgendwie für mich ein Gefühl dafür zu kriegen: Was ist jetzt das Richtige? Was ist jetzt zu tun? So. Soll ich, sollte ich jetzt nicht besser gucken, dass die da keinen Scheiß machen in der Wohnung? Oder soll ich mich jetzt besser auf dieses Ding hier konzentrieren, mir durchlesen, um was es eigentlich geht?
Serafin Dinges: Andreas bleibt sitzen. Erst mal mit dem Staatsanwalt Graulich reden. Andreas erfährt: Die Polizei will wissen, ob auch er involviert war bei dem Artikel, dem Artikel über Linksunten Indymedia. Immerhin ist Andreas, ihr erinnert euch, verantwortlich im Sinne des Presserechts. Aber Andreas, der war nicht involviert, und das sagt er auch. Die Hausdurchsuchung geht trotzdem weiter.
Andreas Reimann: Aber ich habe Ihnen ja gleich gesagt ich habe diesen Artikel eigentlich gar nicht zur Notiz genommen. Mir war gar nicht klar, dass der an dem 30. veröffentlicht wurde. Ich nehme keine Artikel ab. Also damit war für mich sachlich das eigentliche erst mal erklärt und erledigt. Und was die da wirklich wollten, war mir nicht klar.
Serafin Dinges: Und bald stehen die Beamtinnen in der Küche mit allem, was sie in Andreas‘ Wohnung gefunden haben.
Andreas Reimann: Irgendwann kamen sie mit meinem Handy. Und noch mit dem Handy meiner Frau. Und dann, irgendwann wurde, glaube ich, auch schon der PC aus dem meinem Arbeitszimmer im ersten Obergeschoss im Flur abgestellt. Da habe ich schon gemerkt, die haben es auf diese digitalen Devices abgesehen.
Serafin Dinges: Sein Handy, das Handy seiner Frau und der PC aus seinem Arbeitszimmer steht schon am Gang.
Andreas Reimann: Die wollen halt einfach mal Daten haben. Also das ging mir da in dem Moment auch durch den Kopf. Also die wollen offensichtlich ausforschen. Und dann geht mir natürlich im gleichen Moment durch den Kopf: da sind private Dateien drauf, die jetzt wirklich niemanden angehen. Das haben die jetzt auch.
Serafin Dinges: Und während das alles vor sich geht, bekommt Andreas mit: Die Polizei plant noch eine Razzia. Eine dritte, und zwar in der Redaktion von Radio Dreyeckland.
Andreas Reimann: Da habe ich dann dem Herrn Graulich auch gesag, das habe ich dann zu ihm gesagt: Ja, wissen Sie, was Sie da eigentlich machen? Ihnen ist doch schon bewusst, dass Sie da grundrechtssensiblen Bereich betreten? Und trotzdem hatte ich die ganze Zeit über das Gefühl: Das, was die da machen, das werden die Gerichte kassieren. Das ist völlig haltlos. Das geht an Artikel fünf, am Grundrecht und an den ganzen Sachen einfach vorbei. Ähm, das ist völliger Wahnsinn.
Serafin Dinges: Artikel fünf Grundgesetz. Was Andreas da anspricht, das ist die Meinungs- und Pressefreiheit. Die soll dafür sorgen, dass der Rundfunk frei berichten darf. Und Andreas findet dieses Grundrecht, das sollte ihn eigentlich vor so einer Razzia schützen. Geklappt hat es offensichtlich nicht. Und jetzt wollen die Polizist:innen auch noch in die Redaktion von Radio Dreyeckland rein. Andreas ist klar: Wenn das passiert, dann will er dabei sein. Heißt also: Ortswechsel. Der Trupp verlässt die Wohnung. Auf zur nächsten Razzia. Und Andreas? Den nehmen sie einfach mit.
Andreas Reimann: Da waren glaube ich drei, vier Autos bei uns auf der Wendeplatte. Ich bin dann mit dem Graulich und einem irgendwie immer sehr leutselig wirkenden Beamten, der auch so ein bisschen humorig war… Der meinte dann so im Auto: Ach, Herr Reimann, wir müssen Ihnen jetzt, glaube ich, hinten keine Handschellen anlegen oder so was, nicht wahr? Sie verhalten sich ja kooperativ. Und das war jetzt gar nicht mal so… manchmal, wenn Polizisten so etwas zu einem sagen, dann dann merkt man: Oh, die meinen das ernst. Aber da hatte ich schon das Gefühl, der meint das ironisch. Das war fast schon so ein bisschen… „Freut mich, dass Sie so nett sind, Herr Reimann. So kooperativ.“ Aber ich fand das schon auch ein bisschen gespenstisch, muss ich zugeben.
Serafin Dinges: Freiburg, gleicher Tag. 17. Januar 2023. Es ist jetzt kurz vor 8:00 Uhr morgens. Langsam geht die Sonne auf, und durch den Hof mit der üppigen Kletterpflanze an den Wänden, im Studio von Radio Dreyeckland, da steht gerade Meike Bischoff am Mikrofon.
Die Meike: In der freien Radioszene bin ich halt einfach die Meike.
Serafin Dinges: Meike ist so die perfekte Radio-Persönlichkeit. Jemand, der einfach sofort drauflos reden kann und gute Laune verbreitet. Am 17. Januar, da macht sie gerade die Sendung am Morgen fertig.
Die Meike: Na ja, ich bin dann halt die Erste, wenn ich hier kurz vor acht ins Radio schneie. Wahrscheinlich noch ein bisschen verschlafen, fahre die Technik hoch, mach halt mein Ding…
Stimme im Radio: Morgenradio auf Radio Dreyeckland.
Die Meike: … hatte ein Liveinterview abgemacht mit einem Kollegen, der in Lützerath gerade war. Also easy going. Ich meine Routine. Ich schmeiße Nana Mouskouri rein, um acht, „Guten Morgen, Sonnenschein“, so, und den Jingle, und dann ja, dann mache ich halt hier meine Routine.
Nana Mouskouri: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht bleibt dir verborgen. Doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht traurig sein.
Serafin Dinges: Aber Meike ist noch nicht ganz klar, welche Geister sie da gerade weckt mit „Guten Morgen, Sonnenschein“. Sie steht im Studio von Radio Dreyeckland, einem selbstgebauten Kabuff mit einem großen Radio Mischpult. Es riecht nach Sperrholzplatten, und wenn die Tür zu ist, dann wird es schnell stickig.
Die Meike: Schönen guten Morgen, alle da draußen. Ihr seid bei Radio Dreyeckland auf der 102,3 Megahertz oder im Livestream auf www.rdl.de
Serafin Dinges: Die steht da und kann durch eine Fensterscheibe von ihrem Studio in ein zweites Interviewstudio mit Mikrofonen schauen. Heute Morgen stehen da nur leere Stühle. Und durch diese Kabine wiederum schaut Maike durch ein weiteres Fenster in den Eingangsbereich. Während Meike also wie so vielen Morgen davor die Sendung plant, braut sich draußen was zusammen. Und Andreas? Der bekommt alles mit.
Andreas Reimann: Es gibt hier eben um es ums Eck in der Nachbarstraße gibt es einen Parkplatz, einen öffentlichen Parkplatz, so eine Parkfläche. Die war zu der Uhrzeit um acht noch ziemlich leer. Da sind wir draufgefahren. Da waren dann noch weitere Autos. Als wir da angekommen sind, waren da schon Beamten auf dem Parkplatz zugange oder standen da rum. Dann ist da der Staatsanwalt ausgestiegen, ich dann auch. Und der ist dann gleich zu denen hin. Das war dann klar: Das ist quasi jetzt die Truppe, die das Radio durchsuchen soll. Der Graulich ist dann zu denen hin und hat die ein Stück weit gleich mal so eingenordet, nach dem Motto: Jetzt durchsuchen wir keine Privatwohnung. Also das habe ich wirklich gehört. Was wir jetzt betreten, ist der Raum eines Radiosenders. Da war schon mal die Ansage: Ihr dürft euch jetzt nicht einfach so verhalten, wie ihr das vielleicht gewohnt seid, wie man das bei Privatwohnungen je nachdem macht. Das fand ich auch spannend. Genau. Aha. Also, da ist Ihnen jetzt schon klar: Jetzt die Türschwelle ist noch mal eine besonders sensible Türschwelle, wenn es dann in die Studioräume reingeht.
Serafin Dinges: Staatsanwalt Graulich, Andreas und die Beamt:innen schreiten zum Innenhof. Der mit der schönen Kletterpflanze. Nur dass die im Winter karg und braun ist. Die schreiten durch den Innenhof zur Tür von Radio Dreyeckland. Und Andreas soll diese Tür jetzt öffnen.
Andreas Reimann: Also ich wurde ja nicht gefragt, also: „Dürfen wir rein?“ oder so was. Sondern mir wurde ja ein Durchsuchungsbefehl vor die Nase gehalten. Also ich habe auch gar keine… also ich habe aufgemacht, weil ich den Eindruck hatte: Wenn ich das jetzt nicht tue, dann werden die zu drastischeren Maßnahmen greifen.
Serafin Dinges: Meike hätte von ihrem Studio aus einen direkten Blick auf die Tür gehabt. Aber ausgerechnet in diesem Moment schaut sie nicht hin.
Die Meike: Ja, ich sitz hier, das ist völlig skurril. Weil normalerweise siehst du ja, wenn da jemand reinkommt, durch die Tür. Du hsat die Eingangstür von hier ja im Blick durch diese drei Fenster, durch zwei Studios durch. Und ich hab’s nicht mitgekriegt, dass sie da reinkamen.
Serafin Dinges: Während sich Meike auf die Sendung konzentriert, kommt die Polizei in die Redaktion. Und wer weiß, wie lange das noch so gegangen wäre, wenn Meike nicht Durst gehabt hätte.
Die Meike: Jedenfalls hatte ich halt meine Teetasse draußen, und hier im Studio ist Getränkeverbot inzwischen – aus guten Gründen. Ich bin da raus, und hier ist ja unsere Minibar, weißt…
Serafin Dinges: Ok, und da hast du deine Tasse.
Die Meike: Jaja, das hatte ich dann meine Teetasse. Ich nehme so einen Schluck, und dann plötzlich hier so gefühlt zwölf Polizisten. Und ich glaube es waren auch nur Typen. Und ich so: Hä? Was machen die hier?
Serafin Dinges: Nach Fabian und Andreas ist Meike an diesem Morgen die dritte Person, die vollkommen überrascht auf einen Haufen Polizist:innen schaut.
Die Meike: Und ich war dann so: Ihr dürft hier nicht rein, das ist Privatgelände. Und dann habe ich aber auch schon unseren Geschäftsführer da stehen sehen und der hat mich wahrscheinlich auch gesehen, wie ich da so guck wie so ein Auto.
Serafin Dinges: Der Geschäftsführer, von dem Meike spricht, das ist Andreas.
Andreas Reimann: Und dann habe ich eben zu Meike gesagt, weil sie.. sie guckte dann irgendwie etwas verdutzt, weil um die Uhrzeit sind normalerweise nicht so viele Leute im Radio. Dann meinte ich ja, hier ist die Polizei, Hausdurchsuchung. Irgendwie so was. Und dann kam schon so von den Leuten, die um mich herum standen, so Gemurmel wie: Na ja, dann ist es ja jetzt öffentlich. Dann geht es ja jetzt über Sender.
Serafin Dinges: Währenddessen spricht sich die Razzia rum. Die Autos der Polizei bleiben nicht unbemerkt. Bei Meike klingelt das Telefon.
Die Meike: Und dann ruft noch meine Kollegin an, relativ aufgelöst an, sagt: Äh, Meike, die Polizei steht vor der Tür. Nicht reinlassen! Und ich so: Ja, ist leider schon zu spät. Die sind schon da. Aber Andreas ist auch dabei. Ah ja, okay, Andreas ist dabei, dann ist ja gut.
Serafin Dinges: Und Andreas fragt sich: Nehmen die Beamt:innen denn jetzt gleich den ganzen Laden auseinander?
Andreas Reimann: In dem Moment war mir auch gar nicht so klar: Werden die jetzt den Server einfach mitnehmen? So, so physisch mitnehmen, die Geräte einpacken oder so? Da liegen ja auch Skripte, Rohmaterial der letzten vermutlich 20 Jahre liegen digitalisiert da rum. Also das ist schon ganz viel heftiges Material, was niemanden was angeht und die staatlichen Behörden in einer Demokratie schon gar nicht.
Serafin Dinges: An der Stelle zählen wir mal durch. Andreas ist in der Redaktion. Meike ist in der Redaktion. Aber wo ist Fabian? Der ist noch auf dem Weg – und war dabei nicht untätig. Er hat inzwischen mit seiner Anwältin telefoniert. Angela Furmaniak. Die Anwältin ist schon bestens in dem Thema drin, denn Furmaniak hatte auch Betroffene bei den Ermittlungen zu Linksunten Indymedia vertreten. Die Anwältin ruft direkt den Staatsanwalt an: Manuel Graulich. Das Ergebnis ist so eine Art Deal. Wenn sich Fabian noch mal ganz offiziell als Verfasser des Artikels bekennt, dann wird die Razzia in der Redaktion gestoppt. Dann rühren die Beamt:innen nichts an. Mit diesem Plan radelt Fabian also in die Redaktion. Die Polizist:innen hatten zwar angeboten, ihn im Auto mitzunehmen, aber darauf hatte Fabian nach der Razzia weniger Lust, sagt er. Also ab aufs Fahrrad. Einmal durchgelüftet und immer noch ohne Frühstück, schlägt Fabian in der Redaktion auf.
Fabian Kienert: Und das saß eben dann jetzt so der Staatsanwalt… saß an diesem Tisch in den Räumlichkeiten von Radio Dreyeckland und hat praktisch auf mich gewartet, weil es die Kommunikation gegeben hat zwischen ihm und meine Anwältin, dass ich eine Erklärung abgeben werde. Und der Durchsuchungsbeschluss, der hätte es hergegeben, dass praktisch Sie die komplette Infrastruktur von Radio Dreyeckland beschlagnahmt hätten, wenn ich diese Erklärung nicht abgegeben hätte.
Serafin Dinges: Um zu beweisen, dass wirklich nur er der Autor ist, bekommt Fabian seinen Laptop wieder. Zumindest ganz kurz. Er loggt sich bei Radio Dreyeckland ein und präsentiert den Bearbeitungsverlauf des sagenumwobenen Artikels. Und dort, so beschreibt es Fabian, war ganz klar zu sehen: Ja, nur er hat das geschrieben. Andreas und Meike schauen zu, wie Fabian gerade ihren Radiosender vor dem Zugriff der Polizei rettet.
Andreas Reimann: Ich wollte auch dabei sein, wie dann dieser PC Laptop geöffnet und gestartet wird. Ich wollte sehen, was die da machen, auch um das im Nachhinein auch bezeugen zu können.
Serafin Dinges: Eine gefühlte Ewigkeit starrt die Polizei auf dem Bildschirm. So beschreibt Meike das. Und dann geben sie sich zufrieden. Fabian ist der einzige Autor. Das wurde jetzt noch mal für alle Anwesenden demonstriert. Die Polizei verlässt die Redaktion und bei Radio Dreyeckland klingelt wieder das Telefon. Am Apparat: die Deutsche Presseagentur, kurz die dpa.
Andreas Reimann: Da war ich schon auch noch ein bisschen aufgeregt. Aber da habe ich schon gemerkt: Aha, da meldet sich jetzt die dpa. Also da meldet sich jetzt die Öffentlichkeit, da ist ein Interesse.
Serafin Dinges: Noch am selben Tag berichten auch der SPIEGEL über die Razzien, der SWR, die taz und der Deutschlandfunk. Und am nächsten Tag sammeln sich rund 250 Freiburger:innen auf dem Platz der alten Synagoge zu einer spontanen Kundgebung. Und die Protestierenden sind sauer.
Stimme auf einer Demo: Die Durchsuchungen sind ein Frontalangriff auf die Pressefreiheit als Ganzes. Getroffen hat es RDL, gemeint sind wir alle…
Stimme auf einer Demo: …Zeichen gegen diese repressive Kackscheiße zu setzen und zu zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Finger weg von linken Medien!…
Stimme auf einer Demo: Welch ein Riesen-Polizeiaufgebot, mit welcher Unverschämtheit, die in die Räume von den Leuten eingedrungen sind…
Stimme auf einer Demo: Finger weg von unseren Strukturen. Wir sind alle Radio Dreyeckland…
Stimme auf einer Demo: … überfallen haben. Und das Ganze zahlt der Staat. Ich kann’s nicht fassen. Wo sind wir? Diese Aktion ist eine Blamage für die Demokratie. Ich wiederhole: Es ist eine Blamage für die Demokratie! Pressefreiheit! Pressefreiheit!
Mengenmenge: Pre-sse-frei-heit! Pre-sse-frei-heit! (…)
Stimme auf einer Demo: Pressefreiheit in Deutschland! Ich fordere Pressefreiheit! (…)
Andreas Reimann: Der Stress viel von mir ab, glaube ich, als irgendjemand kam und, ja ,erst mal so Betroffenheit gezeigt hat, Empathie gezeigt hat, und gefragt hat: Können wir irgendwas für dich tun? Und dann meinte ich: Ja, du könntest mir jetzt einfach ne Laugenbrezel kaufen in der Bäckerei.
Anruf bei Sebastian
Sebastian Meineck: Hallo, Serafin.
Serafin Dinges: Hallo. Sebastian Meineck, Autor dieser Folge. Willkommen zur Werbepause.
Sebastian Meineck: Hallo.
Serafin Dinges: Woran arbeitest du gerade? Wobei erwische ich dich?
Sebastian Meineck: Ich bin tatsächlich in dieser Sekunde dabei zu schauen, ob es unser Podcas- Cover auch noch lesbar ist, wenn man es sehr, sehr klein vor sich sieht. So wie das dann aussieht, wenn man das auf der App vor sich hätte. Es ist eine wirklich seltsame Aufgabe, denn wir haben natürlich dieses Cover in einer riesigen Auflösung ausspielen lassen. Und jetzt sitze ich da vor Gimp und zieh das so auf 100 mal 100 Pixel. Und gucke, ob man noch „Systemeinstellungen“ lesen kann.
Serafin Dinges: Wenn du gerade nicht Cover ganz klein siehst, dann schreibst du ganz schön viel für netzpolitik.org. Netzpolitik ist vor allem durch Spenden finanziert. Wie ändert das deine Arbeit?
Sebastian Meineck: Das ändert die Arbeit radikal. Das war wir gar nicht klar, als ich da angefangen hatte. Unser Ziel ist es wirklich, Entwicklungen zu begleiten, die relevant sind. Es ist für uns erst mal egal, ob das durch die großen Medien geht, ob das viele Klicks bringt, ob das zu einer bestimmten Zielgruppe passt. Wir sind allein dem Thema verpflichtet, also in diesem Fall dem Kampf für digitale Freiheitsrechte.
Serafin Dinges: Heißt das für dich, dass du mehr Freiheit hast oder mehr Angst, dass die Leute nicht mehr spenden, wenn du nicht die richtigen Sachen schreibst?
Sebastian Meineck: Auf jeden Fall mehr Freiheit. Nee, Angst habe ich da überhaupt nicht. Natürlich, unsere Finanzierung ist immer jedes Jahr – Stabhochsprung. So vergleiche ich das gerne. Immer im Dezember, wo typischerweise die meisten Spenden reinkommen, fragen wir uns: Erreichen wir das Budgetziel? Können wir so weitermachen? Nee, aber thematisch bedeutet das eine unheimliche Freiheit.
Serafin Dinges: OK, wer dabei mithelfen will, dass Sebastian im Dezember nicht Angst haben muss, dass das Spendenziel nicht erreicht wird, findet alle Infos unter netzpolitik.org/spenden. Aber erst mal weiter mit der Folge und du machst die Grafik fertig.
Sebastian Meineck: Ich gucke mir das jetzt noch mal genau an!
Serafin Dinges: Vielen Dank.
Sebastian Meineck: Mach’s gut.
Serafin Dinges: Ciao!
Akt 3: Pressefreiheit
Serafin Dinges: Heute ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht mehr gegen Andreas. Die Vorwürfe hat sie schnell fallen gelassen, nicht aber die Vorwürfe gegen Fabian. Als Autor des Artikels soll Fabian die Tätigkeit einer verbotenen Vereinigung unterstützt haben. So lautet der Vorwurf. Und zwar indem Fabian die verbotene Vereinigung, also Linksunten Indymedia in seiner Meldung nicht nur genannt hat, sondern auch verlinkt. Richtig gehört. In Fabians Meldung steht der Link zur Website. Ich sage das jetzt ganz vorsichtig: linksunten PUNKT indymedia PUNKT org. Um das noch mal klar zu machen Fabien hat jetzt nicht geschrieben: Hey, schaut euch mal diese krass verbotene Website an! Er hat über die Einstellung eines Gerichtsverfahrens geschrieben und dabei erwähnt, Zitat: „Im Internet findet sich linksunten.indymedia.org als Archivseite“.
Serafin Dinges: Und so ist es auch: Die Webseite von Linksunten, wie sie früher war, die gibt es nicht mehr. Neue Beiträge kann man dort nicht mehr posten. Seit 2020 gibt es unter der gleichen Adresse nur noch ein Archiv mit den alten Beiträgen. Trotzdem findet die Staatsanwaltschaft: fabian hat mit diesem Link eine verbotene Organisation unterstützt. Deshalb drohen Fabian eine Geldstrafe und bis zu drei Jahre Gefängnis. Um noch deutlicher zu machen, wie absurd das Ganze ist: Das Bundesinnenministerium hat diesen Link zu Linksunten schon selbst vor ein paar Jahren veröffentlicht. 2018 twitterte das Innenministerium, Zitat: „Verboten wurde die unter der URL linksunten.indymedia.org abrufbare Internetseite.“ Und für genau diesen Link soll Fabian also vor Gericht. Und weil das Ganze so sonderbar ist, nutzt Radio Dreyeckland in seinen Berichten über den Fall ein Wortspiel: Link-Extremismus, also Extremismus durch einen Link statt Links… Vielleicht muss ich den Witz auch gar nicht erklären. Jetzt also die Frage: Geht das? Kann ein Journalist wegen eines Links ins Gefängnis? Fabian glaubt nicht dran.
Fabian Kienert: Es gibt zwar Leute, die sage: Man sollte nicht naiv davon ausgehen, dass man auf jeden Fall nicht verurteilt wird. Aber ich gehe davon aus, dass ich nicht verurteilt werde.
Serafin Dinges: Fabian spekuliert, der gesamte Fall Radio Dreyeckland könnte ein Einschüchterungsversuch sein, und zwar gegen die linke Szene, lanciert von Beamt.innen, die frustriert sind von dem erfolglosen Ermittlungen rund um Linksunten Indymedia.
Fabian Kienert: Ich glaube, da ist einfach irgendwie auch der Wille auch zu diesem ganzen Linksunten… Endlich mal irgendwie noch mal was zu finden, wo man Leute irgendwie greifen kann. Und scheinbar gibt es da im Freiburger Staatsschutz Leute, die halt auch auch Radio Dreyeckland regelmäßig besuchen, um endlich irgendwann mal was zu finden. Und dass da vielleicht auch ein gewisser Ärger über Polizei-kritische Berichterstattung auch von mir da ist, würde ich schon annehmen.
Serafin Dinges: Er selbst sagt, er würde seinen Artikel wieder so schreiben. Er steht dazu. Die Hausdurchsuchung hat ihn aber trotzdem mitgenommen.
Fabian Kienert: So, die ersten Wochen nach der Hausdurchsuchung habe ich schon nicht so gut geschlafen. Und so Klingeln zu ungewöhnlichen Uhrzeiten, das ist schon, finde ich, immer noch irgendwie belastend. Da geht schon plötzlich irgendwie immer noch so ein Film an.. ich mach den Computer schnell aus, wenn es nur irgendwie klingelt.
Serafin Dinges: Wir haben versucht, für diesen Podcast auch mit dem Freiburger Staatsschutz und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zu sprechen und so Interview-Anfragen wurden aber schriftlich abgelehnt. Das es den Behörden mit ihren Razzien auch um Einschüchterung ging, daran glaubt auch Meike.
Die Meike: Ja definitiv. Und hat auch geholfen, also: hat gewirkt sozusagen. Also hat genau den Zweck erfüllt, den es sollte. Wir hatten den Fall… wir hatten so junge Praktikantis danach in der Aktuellen, und der war total verunsichert. Also der hat dann irgendwie gefragt: Kannst du uns da irgendwie noch mal eine Liste machen mit Leuten, die wir nicht anfragen sollten? Oder irgendwie so in in der Hinsicht. Und wir so: OK, Stopp, Stopp, Stopp. Du hast es nicht verstanden. Also kalr, der war ganz neu in dem Gebiet, so, ne? Aber wir machen hier Journalismus. Du darfst meinetwegen Charles Manson im Gefängnis anfragen zu einem Interview. Das ist das, was unser Job hier so ist. Wir sollen die Öffentlichkeit darüber informieren, was passiert. Und ihr Bild machen können die Leute sich dann selber, so..
Serafin Dinges: Andreas kontextualisiert das alles noch mal etwas. Er sagt: Der Sender ist eben nicht die Badische Zeitung oder die Tagesschau.
Andreas Reimann: Und das ist meine Vermutung letztlich auch, dass es uns getroffen hat und nicht andere Medien, die ja über den Sachverhalt damals zu dem Linksunten-Indymedia-Verfahren auch berichtet hatten… dass wir eben wahrscheinlich im Blick der Staatsanwaltschaft kein seriöses Medium sind. Sondern eben ein Medium, was in ihrer Denke in irgendeiner links-aktivistischen Schublade liegt. Wahrscheinlich in der gleichen Schublade, wo auch ein Portal wie Linksunten Indymedia liegt, das noch mal, glaube ich, ein anderes Grundverständnis hat von Journalismus als wir. Vielleicht ist auch so eine Denke dahinter: Die, naja, die arbeiten ja nicht für Geld. Also dann haben sie ja wohl andere Interessen. Nämlich irgendwie links-aktivistische Interessen oder sowas. Also das man aus Engagement heraus, aus Verantwortung heraus Journalismus macht… Leben können die meisten Journalistinnen ja ohnehin nicht wirklich gut davon… das scheint bei denen nicht angekommen zu sein.
Serafin Dinges: Neun Monate nach der Razzia gibt es einen ersten Erfolg für Meike und den Sender, für Andreas und Fabian. Sie hatten Beschwerde gegen die Razzien eingereicht und das Landgericht Karlsruhe hat entschieden: Jawohl, die Hausdurchsuchungen waren rechtswidrig. Das bedeutet, die Polizei hätte an diesem einem Januarmorgen nicht bei Andreas und Fabian in die Wohnung gehen dürfen, nicht ihre Papiere durchwühlen, nicht in die Redaktion eindringen. In seinem Beschluss teilt das Landgericht Karlsruhe heftig gegen die Razzien aus. Es schreibt vom Einschüchterungseffekt, den so eine Hausdurchsuchung hat. Einschüchterung nicht nur für Fabian und Andreas. Auch für andere Redaktionsmitglieder, die kritisch über staatliche Angelegenheiten berichten. Einschüchterung für Informant:innen, die sich mit vertraulichen Infos an die Redaktion wenden. Das Gericht kommt zum Schluss: Die Presse und Rundfunkfreiheit, die wurde bei den Razzien nicht ausreichend berücksichtigt. Wenige Monate später dann auch wieder der Dämpfer: das Oberlandesgericht Stuttgart hat die Entscheidung vom Landgericht teilweise wieder einkassiert. Das Oberlandesgericht sagt: Diese eine Razzia bei Fabian, die war doch okay. Man hätte eben rausfinden müssen, wer den Artikel verfasst hat. Ein Hin und Her also. Aber das ist noch immer nicht das letzte Wort. Fabian hat mit seinen Anwältinnen Verfassungsbeschwerde gegen die Razzia eingereicht. Bisher noch ohne Ergebnis. Und Fabian muss sich jetzt in Karlsruhe vor dem Landgericht verantworten. Der Vorwurf: Unterstützung einer verbotenen Vereinigung. Neun Prozesstage sind angesetzt, verteilt über mehrere Wochen. Der erste Prozesstag war kurz vor Erscheinen dieser Podcastfolge – am 18. April. Weitere Berichterstattung findet ihr auf netzpolitik.org. Und Andreas? Der ist zwar nicht mehr im Visier der Justiz. Seine Geräte hatten die Beamt:innen trotzdem eingesackt. Überlegt euch mal: Was habt ihr alles auf dem Handy? Was steht in euren Chatverlauf? Was für Fotos habt ihr in der Cloud? Und wie fühlt sich das an, wenn ihr denkt: Vielleicht können all das jetzt fremde Augen sehen, irgendwo bei der Staatsanwaltschaft? Beim Handy von Andreas zum Beispiel, da gab es keine Sperre, keine Verschlüsselung. Da lag alles offen.
Andreas Reimann: Ich musste dann wirklich auch dem Moderator meiner von meinem von unserem WhatsApp-Sportgruppe sagen: Nimm mich mal raus. Mein Handy liegt bei der Staatsanwaltschaft. Die können gerade alles sehen, was wir… auch wenn das im Grunde ganz harmlos ist, so… Wer geht wann, wer hat Lust, am nächsten Freitag mal morgens um acht joggen zu gehen… das liegt jetzt alles bei der Staatsanwaltschaft. Das ist mir peinlich, bitte versuch ganz schnell, mich noch rauszunehmen. Vielleicht haben Sie dann zumindest auf das, was seit der Hausdurchsuchung im Chat war, keinen Zugriff mehr.
Serafin Dinges: Andreas erinnert sich auch heute noch genau an den Abend vom 17. Januar 2023. Der Abend nach den Razzien. Der Ärger war vorbei ,und Andreas war wieder im Schlafzimmer, da, wo für ihn am Morgen alles angefangen hat.
Andreas Reimann: Das weiß ich noch genau. Wir waren auch nicht so schrecklich spät zu Hause und ich habe mich ins Bett gelegt. Und dann liege ich da im Bett. Und der erste Gedanke war: Die läuten wieder morgens um sechs. Also da kam sofort dieses Scheißgefühl hoch. Und meine Frau, die dann nach mir ins Bett kam, die hat mir später gesagt: Es ging ihr genauso. Das hat sie in dem Moment gar nicht so erwähnt, aber sie ist mit dem gleichen Gefühl ins Bett gegangen: die kommen wieder. Also da ist erst mal was kaputt. Da ist man erst mal irgendwie auf eine Art angegriffen, und das wirkt nach. Das hat sich nach ein paar Tagen dann gelegt. Aber das hat nachgewirkt.
Serafin Dinges: Systemeinstellungen ist eine Produktion von netzpolitik.org, dem Medium für digitale Freiheitsrechte. Host und Producer bin ich, Serafin Dinges. Unsere wunderbare Redaktion sind: Anna Biselli, Chris Köver, Ingo Dachwitz und Sebastian Meineck. Titelmusik von Daniel Laufer und zusätzliche Musik von Blue Dot Sessions und mir. Coverdesign: Lea Binsfeld. Besonderen Dank an Lara Seemann und Lena Schäfer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung und wenn ihr ihn weiterempfiehlt. Bis zum nächsten Mal.
Serafin Dinges: Nächstes Mal bei Systemeinstellungen:
Sandra Menzel: Ich denke so schnell kann das gehen das man irgendwie von so einer hoch gelobten Flüchtlingsaktivistin und wunderbare Arbeit dann da niederfällt in eine angezeigte Straftäterinnen, gegen die mit einer Hausdurchsuchung ermittelt werden muss.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
2017 hat die EU-Kommission eine Hintertür für Pushbacks nach Libyen geschaffen. Im gleichen Jahr begann Sea-Watch die Beobachtung dieser Menschenrechtsverletzungen aus der Luft. Damit soll nun Schluss sein.

Schiffe von EU-Staaten dürfen Asylsuchende nicht in Folterstaaten wie Libyen zurückbringen. Um dieses Verbot für sogenannte Pushbacks zu umgehen, hat die EU-Kommission eine Hintertür im Völkerrecht geschaffen und seit 2017 eine libysche Küstenwache mitaufgebaut. Die Truppe entführt Geflüchtete in internationalen Gewässern, inhaftiert sie in Folterlagern, regelmäßig setzt sie bei diesen Pullbacks Waffen ein und lässt Menschen ertrinken.
Ebenfalls seit 2017 beobachtet die Organisation Sea-Watch diese Menschenrechtsverletzungen aus der Luft und informiert die zuständigen maritimen Leitstellen über Boote in Seenot. Damit soll nun Schluss sein: Die italienische Luftfahrtbehörde ENAC hat am Montag eine Anordnung veröffentlicht, die den Einsatz von Flugzeugen ziviler Rettungsorganisationen über dem Mittelmeer verbietet. Zur Begründung heißt es, die Flüge gefährdeten „die Sicherheit von Migranten“.
„Das Flugverbot ist politisch motiviert und rechtlich nicht haltbar. Mitten im Europawahlkampf versucht Italien, die letzten Zeug:innen der europäischen Verbrechen im Mittelmeer loszuwerden”, kommentiert Oliver Kulikowski von der Airborne-Abteilung von Sea Watch.
Sea-Watch dokumentiert Beteiligung von Frontex
Laut der Anordnung betrifft das Verbot Flüge im Osten und Westen Siziliens. Davon umfasst ist auch Lampedusa, wo Sea-Watch das zweimotorige Flugzeug „Seabird 2“ stationiert. Es wird von der Schweizer humanitären Piloteninitiative (HPI) betrieben und trägt deshalb das Hoheitszeichen der Schweiz. Auch die „Colibri“ von Pilotes Volontaires aus Frankreich unternimmt Aufklärungsflüge für Sea-Watch im Mittelmeer und ist deshalb ebenso von dem Verbot betroffen.
Allein zwischen Januar und März dieses Jahres haben die Sea-Watch-Flieger 40 Einsätze mit insgesamt 205 Flugstunden absolviert. Dabei haben die Besatzungen 2.755 Menschen in Seenot in 47 Booten gesichtet. Alle Vorfälle wurden wie vorgeschrieben an die Leitstellen der benachbarten Seenotrettungszonen in Malta, Italien und Libyen gemeldet.
Mehr als 700 Menschen wurden anschließend von der libyschen „Küstenwache“ abgefangen und nach Tripolis zurückgebracht. In mindestens acht Fällen konnte Sea-Watch dabei die Beteiligung der europäischen Grenzagentur Frontex nachweisen.
Gesetz gegen Rettungsschiffe auf Luftraum erweitert
In der Anordnung behauptet die ENAC, der Einsatz von Flugzeugen sei eine „unangemessene Interventionsmaßnahme“ und führe dazu, „dass Migranten von den nordafrikanischen Routen in Rettungsbooten abgeholt werden“. Weiter heißt es, die Seenotrettung obliege allein den dafür zuständigen Behörden. Dazu verweist die Luftfahrtbehörde auf internationale Verträge wie das SOLAS-Übereinkommen zur Rettung von Menschen auf See.
Keiner der genannten Verträge verbietet es jedoch, dass zivile Organisationen Rettungsschiffe oder Flugzeuge außerhalb von Hoheitsgewässern betreiben und über entdeckte Seenotfälle die nationalen Leitstellen informieren.
Die Luftfahrtbehörde ENAC untersteht dem italienischen Verkehrsministerium, das von Matteo Salvini geleitet wird. Der rechtsradikale Lega-Politiker war von 2018 bis 2019 Innenminister und hatte zu dieser Zeit bereits erfolglos versucht, die zivilen Seenotretter mit von ihm erlassenen Dekreten an die Kette zu legen.
Erst Anfang 2023 war die Regierung unter der Postfaschistin Giorgia Meloni damit erfolgreich: Per Gesetz werden Kapitän:innen gezwungen, nach einer Rettungsaktion sofort einen zugewiesenen Hafen anzusteuern, der tausende Kilometer entfernt sein kann. Werden weitere Menschen aus Seenot an Bord genommen, drohen eine Geldstrafe von 20.000 Euro und die wochenlange Festsetzung des Schiffes.
Sea-Watch fliegt weiter
Dieses Gesetz zur Repression gegen Rettungsschiffe hat die ENAC nun auf auf den Luftraum erweitert. Wer Rettungsmaßnahmen „außerhalb des geltenden Rechtsrahmens“ durchführt, wird demnach mit Sanktionsmaßnahmen sowie „Verwaltungshaft“ für die Flugzeuge bestraft.
Die Anwälte von Sea-Watch arbeiten bereits daran, gegen die Anordnung vorzugehen. Das Flugverbot kann wie die Repressalien gegen die zivilen Rettungsschiffe vor italienischen Verwaltungsgerichten angefochten werden. In den vergangenen Wochen waren die Organisationen SOS Mediterranée aus Frankreich und SOS Humanity aus Deutschland dazu erstmals erfolgreich. Unter anderem argumentierten die Richter:innen, Italien habe nicht das Recht, Schiffe für angebliche Taten auf hoher See zu sanktionieren, wenn diese nicht unter italienischer Flagge fahren. Auch der Vorwurf, Anordnungen der libyschen Küstenwache nicht zu befolgen, laufe ins Leere, da deren Einsätze nicht als Rettungsaktionen angesehen werden könnten.
Ungeachtet der drohenden Repressalien will Sea-Watch die Gegenüberwachung aus der Luft nicht beenden. Am Mittwochmittag startete die „Seabird 2“ von Lampedusa zu einem Aufklärungsflug. Maßnahmen der italienischen Regierung erfolgten bislang nicht.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Erstmals muss das Europäische Parlament Abrechnungsdaten eines Abgeordneten herausgeben. Weil Ioannis Lagos wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt wurde, überwiegt das öffentliche Interesse, urteilte das Gericht der Europäischen Union.

Der griechische Neonazi Ioannis Lagos sitzt in Griechenland wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung im Gefängnis. Gleichzeitig ist er seit 2019 gewählter Abgeordneter im Europaparlament. Trotz seiner Haftstrafe hat Lagos weiterhin Zugriff auf Gelder des Europäischen Parlaments. Wie er diese verwendet, ist unbekannt.
Die Transparenz-NGO FragDenStaat hatte beim Europäischen Parlament eine Informationsfreiheitsanfrage zu den Geldern des rechtsradikalen Abgeordneten gestellt. Das Parlament lehnte die Anfrage im April 2022 ab. Es gebe generell keine Details über die Abrechnungen von Abgeordneten heraus. Dagegen klagte FragDenStaat vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg – und hat nun Recht bekommen.
In der Pressemitteilung (PDF) des Gerichts heißt es:
Mit seinem heutigen Urteil erklärt das Gericht die Entscheidung des Europäischen Parlaments vom 8. April 2022 für nichtig, soweit den Antragstellern damit der Zugang zu Dokumenten über Herrn Lagos vom Parlament gezahlte Reisekostenerstattungen und Tagesgelder sowie zu Dokumenten über seinen parlamentarischen Assistenten gezahlte Reisekostenerstattungen verweigert wird.
Das Gericht befindet, dass im vorliegenden Fall die Privatsphäre des Abgeordneten hinter dem Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu den Dokumenten zurückstehen muss. Der Antrag ziele darauf ab, eine verstärkte öffentliche Kontrolle und Rechenschaftspflicht zu erleichtern, etwa im Hinblick auf den Zugang von Lagos zu öffentlichen Geldern. Dies aber sei angesichts der außergewöhnlichen Umstände – nämlich der langjährigen Haft des Politikers – gerechtfertigt, so das Gericht. Entsprechende Unterlagen über Tagegelder und Reisekosten von Lagos‘ Mitarbeitern müssten daher herausgegeben werden.
FragDenStaat hält den Fall auch für einen anderen Abgeordneten für relevant. Der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah steht derzeit ebenfalls im Fokus der Medien. Sein Mitarbeiter soll ein chinesischer Spion sein und sitzt aktuell in Untersuchungshaft.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Ein neues Tool von OpenAI soll erkennen können, ob ein Bild echt ist oder mit dem Bildgenerator DALL-E erstellt wurde. Etwas ähnliches hat das gehypte Unternehmen bereits für seine KI-generierten Texte versprochen – und ist daran gescheitert.

Das KI-Unternehmen OpenAI arbeitet an Technologien, um Bilder zu erkennen, die mit seinem populären Generator DALL-E 3 erstellt werden. Das Werkzeug ist Teil eines größeren Pakets von Maßnahmen, mit dem das Unternehmen kurz vor der US-Wahl dafür sorgen will, dass sich seine KI-generierten Inhalte auch als solche erkennen lassen. Werkzeuge wie DALL-E haben es sehr einfach gemacht, täuschend echte Bilder zu erstellen. Fachleute fürchten, dass solche Bilder, Videos oder Tonaufnahmen in anstehenden Wahlkämpfen zur Gefahr werden.
In einem Blogpost schreibt OpenAI, es werde den neuen Detektor zunächst mit Forscher:innen teilen. Diese sollen das Werkzeug testen und Rückmeldungen geben, wie es verbessert werden kann. In internen Tests soll der Detektor bereits mehr 98 Prozent der Bilder von DALL-E 3 richtig erkannt haben. Gleichzeitig schneidet das System laut OpenAI schlechter ab, wenn es darum geht zwischen Bildern von DALL-E und Produkten der Konkurrenz zu unterscheiden, etwa von Stable Diffusion oder Midjourney.
Neuer Standard soll Fakes markieren
In der gleichen Mitteilung sagt OpenAI, es sei dem Lenkungsausschuss der „Coalition for Content Provenance and Authenticity“ beigetreten. Das Gremium, in dem andere Tech-Konzerne wie Adobe, Microsoft, Meta und Google sitzen, arbeitet an einem gemeinsamen Standard zur Beglaubigung von Medieninhalten. Er soll für Bilder, Videos und Ton-Dateien Informationen dazu liefern, wann und mit welchen Werkzeugen sie erstellt wurden. Im Falle eines mit DALL-E 3 generierten Bildes steht dann etwa in den Metadaten der Datei: „Verwendetes KI-Werkzeug: DALL-E“.
OpenAI fügt diese Daten bereits seit Anfang des Jahres automatisch in Inhalte ein, die mit seinen Systemen ChatGPT und DALL-E erstellt werden. Auch in Videos aus dem bislang nicht veröffentlichten System Sora sollen die Metadaten enthalten sein. Nachrichtenorganisationen und Forscher:innen sollen dadurch schneller erkennen können, woher ein Bild stammt.
Allerdings lassen sich solche Metadaten aus Dateien auch leicht wieder entfernen. Wer mit einem Bild, Video oder einer vermeintlichen Tonaufzeichnung bewusst täuschen wollte, würde sie wohl kaum in der Datei belassen. Sie eignen sich nicht, um zu belegen, ob ein Inhalt echt oder KI-generiert ist.
Das weiß auch OpenAI und schreibt: „Menschen können immer noch betrügerische Inhalte ohne diese Informationen erstellen (oder sie entfernen).“ Das Unternehmen plädiert dennoch dafür, solche Standards zu etablieren. Wenn sich die Metadaten erst mal etabliert hätten, würden Menschen misstrauischer gegenüber Medien, bei denen sie fehlten.
Unternehmen im Wahljahr unter Druck
OpenAI reagiert mit seiner Ankündigung auch auf den wachsenden Druck. In den USA stehen dieses Jahr Präsidentschaftswahlen an. Forscher:innen weisen darauf hin, wie gefälschte Inhalte im Wahlkampf eingesetzt werden, um den Ausgang der Wahlen zu beeinflussen. Im Kongress wurden mehrere Gesetzentwürfe eingebracht, die auf KI abzielen, bislang steht aber kein Gesetz kurz vor der Verabschiedung.
Anderswo hat die Politik den Druck schon erhöht: In der EU verpflichtet etwa die neue KI-Verordnung alle Anbieter von KI-Systemen zur Transparenz: Wer Werkzeuge anbietet, mit denen man Bild-, Audio- oder Videoinhalte erzeugen kann, „die Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen deutlich ähneln und fälschlicherweise den Anschein erwecken, authentisch oder wahrheitsgetreu zu sein“, muss diese Inhalte klar kennzeichnen. Das gleiche gilt auch für Plattformen, die solche Inhalte verbreiten.
CEO Sam Altman reiste im vergangenen Jahr um die gesamte Welt, um mit Politiker:innen über OpenAIs Technologien zu sprechen. In der EU konnten die Lobbyist:innen des Unternehmens immerhin erfolgreich verhindern, dass die neuen Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz allzu strikt mit Basismodellen umgehen, die auch die Grundlage von OpenAIs Text- und Bildgeneratoren sind.
Frühere Versuche sind gescheitert
Mit den Ankündigungen dieser Woche signalisiert OpenAI so seine Bereitschaft, der Gefahr selbst entgegenzutreten, die von seinen Werkzeugen ausgeht. Ob das auch gelingt, ist eine andere Frage: In der Vergangenheit ist OpenAI bereits einmal damit gescheitert, die Inhalte aus einen eigenen Generatoren verlässlich zu erkennen. Einen Detektor, der Texte aus ChatGPT von menschlichen Texten unterscheiden sollte, hat das Unternehmen vergangenen Sommer beerdigt: Die Erkennungsquote war zu schlecht.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Der Bundesrat hat das Onlinezugangsgesetz 2.0 im März abgelehnt. Eine Einigung soll nun der Vermittlungsausschuss bringen. Vor der ersten Sitzung Mitte Mai bekräftigen die Länder ihre Forderungen nach mehr Einfluss sowie nach einer stärkeren finanziellen Beteiligung des Bundes.

Ein Schrank voller Akten, stapelweise Mappen auf dem Schreibtisch, daneben händisch ausgefüllte Formulare, die als eingescannte PDFs ins Postfach wandern – so sieht der Alltag in vielen Behörden aus. Mitarbeiter:innen in der öffentlichen Verwaltung müssen sich nach wie vor in Geduld üben, bevor sie vollumfänglich auf digitale Systeme setzen und Bürger:innen, Unternehmen und Organisationen deren Leistungen online beantragen können.
Die lahmende Verwaltungsdigitalisierung soll ein Gesetz seit nunmehr sieben Jahren beschleunigen. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) trat 2017 in Kraft und verpflichtet Bund, Länder und Kommunen dazu, knapp 600 Verwaltungsleistungen für Bürger:innen, Unternehmen und Organisationen online anzubieten. Laut Gesetz sollte dies bis Ende 2022 erfolgen. Die Frist ist längst verstrichen und eine neue Version des Gesetzes liegt nun seit einigen Monaten auf dem Tisch.
Doch das OZG 2.0 hat einen schweren Stand. Zuerst zogen sich die Verhandlungen der Regierungsparteien über Jahre hin, bevor der Bundestag im Februar das Gesetz endlich verabschiedete. Im März folgte dann aber bereits der nächste Dämpfer: Der Bundesrat lehnte das OZG 2.0 ab und stoppte das Gesetzgebungsverfahren damit kurz vor der Ziellinie.
Länder wollen mehr mitreden
Vor allem die unionsgeführten Länder stimmten gegen das Vorhaben – obwohl die Ampel nicht nur die Verbesserungsvorschläge von Sachverständigen in die neue Fassung, sondern auch zahlreiche Forderungen der Länder aufnahm. So können die Länder laut Gesetz weiterhin Elster für die Identifizierung und Authentifizierung verwenden. Die Plattform haben Bund und Länder unter Federführung Bayerns entwickelt, um die Steuererklärungen der Bürger:innen und Unternehmen online einzuholen. Ursprünglich wollte der Bund, dass das Nutzerkonto Bund – kurz BundID – Elster vollständig ablöst.
Vor allem aber adressiert das Gesetz eines der Hauptprobleme der Verwaltungsdigitalisierung: den Flickenteppich digitaler Verwaltungsleistungen von Bund, Länder und Kommunen. Das OZG 2.0 sieht fortan einheitliche Standards und offene Schnittstellen vor. Eben das ist aber der Stein des Anstoßes. Denn die Standards sollen zwar zunächst nur für Bundesleistungen gelten. Die Zuständigkeit, diese festzulegen, liegt aber allein beim Bundesinnenministerium (BMI). Das muss das Ländergremium des IT-Planungsrates lediglich über seine Beschlüsse informieren.
Die passive Rolle des IT-Planungsrates im neuen Gesetz zeige, dass der Bund keine umfassende Standardisierungsstrategie anstrebe, „die alle relevanten Beteiligten aus Verwaltung und Privatwirtschaft angemessen einbezieht“, sagt Reinhard Sager vom Deutschen Landkreistag (DLT) in einer Pressemitteilung. Laut Kay Ruge (DLT) sei der Bund nicht zu Zugeständnissen bereit gewesen.
Das liebe Geld
Nach der Ablehnung im Bundesrat rief der Bund auf Drängen der Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am 10. April den Vermittlungsausschuss an. Die erste Sitzung ist für Mitte Mai vorgesehen, der genaue Termin steht noch nicht fest. Ob Bund und Länder das OZG 2.0 noch gemeinsam in dieser Legislaturperiode verabschieden werden und wie das Gesetz konkret aussehen wird, ist derzeit offen. Das hängt unter anderem davon ab, wie weit die Forderung der Länder geht, die Standards mitzugestalten.
So hält Ruge gegenüber netzpolitik.org eine Einigung im Vermittlungsausschuss nur dann für möglich, „wenn bei der Setzung von Standards für die Digitalisierung auch die Rechte der Länder gewahrt werden.“ Doch die Einigung hängt auch an einem weiteren Punkt: Der Bund müsse die Folgekosten des OZG 2.0 auch mit eigenen finanziellen Beiträgen begrenzen, so Ruge.
Wie sehr die Kosten mit der Umsetzung des OZG 2.0 ansteigen werden, sei laut Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) kaum einzuschätzen. Fest stehe aber, dass sie vor allem Länder und Kommunen belasten werde. Die trügen die Hauptumsetzungslast, begründet Florian Herrmann (CSU) aus Bayern die Ablehnung seines Landes im Bundesrat.
Die Länder hätten zum Teil schon viel in die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung investiert. Das OZG 2.0 mache vieles davon zur Makulatur, kritisiert Schrödter. Schleswig-Holstein etwa habe seine Hausaufgaben erledigt. „Dafür dürfen wir nicht bestraft werden“, so der Landesminister.
FDP verweist auf Schuldenbremse
Der Forderung nach finanzieller Unterstützung erteilt jedoch nicht zuletzt die FDP eine klare Absage. Die Liberalen verweisen ebenso wie die Union auf die Schuldenbremse. Für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sieht der Bundeshaushalt für 2024 nur noch 3,3 Millionen Euro vor. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr veranschlagte die Bundesregierung dafür 377 Millionen Euro.
Während die Länder ihre Forderungen öffentlich äußern, hält sich der Bund im Vorfeld der ersten Ausschusssitzung zurück. Eine Presseanfrage an das BMI dazu, wie eine Einigung zwischen Bund und Ländern aussehen könnte, bleibt unbeantwortet. Aus dem Büro des Bundestagsabgeordneten Lars Zimmermann (SPD) heißt es, man wolle sich nicht zum laufenden Verfahren äußern.
Die grüne Innenpolitikerin Misbah Khan findet derweil klare Worte: „Ich gehe davon aus, dass allen beteiligten Akteuren, aus der Opposition und den Ländern, die Bedeutung der Reform ebenfalls bewusst ist und sich dieses Verfahren nicht für parteitaktische Spielereien eignet“, sagt sie gegenüber netzpolitik.org. Das OZG sei enorm wichtig, damit die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung gelingt.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Reisen über Länder und Verkehrsmittel hinweg zu planen, ist heute immer noch sehr kompliziert. Das neue Mobilitätsdatengesetz soll Abhilfe schaffen und dazu führen, dass vom Fahrplan des lokalen Busunternehmens über den E-Roller bis zur Ladestation die Daten ausgetauscht und vernetzt werden können.

Das Verkehrs- und Digitalministerium von Volker Wissing (FDP) hat laut einem Bericht von Tagesspiegel Background (€) mit leichter Verspätung den Gesetzentwurf für ein Mobilitätsdatengesetz vorgelegt. Idee des Gesetzes ist eine bessere Vernetzung von Mobilitätsdaten. So soll mit dem Gesetz unter anderem die „Kleinstaaterei“ beendet werden, bei der Nutzer:innen bei einer Reise von A nach B für verschiedene Transportmittel vom E-Roller über Zug bis zum Taxi verschiedene Dienste, Apps und Tickets nutzen müssen.
„Indem wir mehr und bessere Mobilitätsdaten zur Verfügung stellen, werden multimodale Reise und Echtzeit-Verkehrsinformationsdienste nicht nur ermöglicht, sondern auch deren Buchung und Bezahlung“, sagt Ben Brake, Leiter der Abteilung Digital- und Datenpolitik im BMDV zu Tagesspiegel Background.
In welcher Form die Mobilitätsdaten dann geteilt werden sollen, legt der Gesetzentwurf laut Background allerdings nicht fest. Auf Vorgaben wolle das Verkehrs- und Digitalministerium (BMDV) verzichten, weil sich aufgrund des technischen hin Fortschritts schnell Änderungen ergeben könnten. Stattdessen soll in Zukunft ein „Bundeskoordinator“ diese Frage regeln. Laut dem Bericht soll dieser Bundeskoordinator Leitlinien erlassen, welche die Spezifikationen, Standards, Anforderungen und Formate der Daten festlegen sowie die Zusammenarbeit zwischen den Dateninhabern und den Datennutzern regeln.
Koordinationsstelle geplant
Diese Koordination der Mobilitätsdaten soll in Zukunft die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) übernehmen und bekommt dafür laut Entwurf offenbar 22 Stellen zugesprochen. Bei der BASt liegt auch der von der EU vorgeschriebene Nationale Zugangspunkt für Mobilitätsdaten. Aufgabe der Bundesanstalt wird laut dem Bericht zudem sein, „national und international tätige Dateninhaber von Mobilitätsdaten zur Datenbereitstellung“ anzuregen und zu erklären, wie die Bereitstellung funktioniert. Zudem soll die BASt auch Beschwerden über Qualität und Rechtskonformität der Daten entgegennehmen. Eine Aufgabe, die man eher bei einer kontrollierenden Stelle erwartet hätte. Personenbezogene Daten sind laut dem Gesetzentwurf vom Teilen ausgeschlossen.
Damit die Unternehmen wirklich Daten zur Verfügung stellen, soll es in Zukunft auch Strafen geben. Diese fallen allerdings laut dem Entwurf mit „bis zu 10.000 Euro“ eher gering aus. Die Kontrolle und Aufsicht über die Daten soll beim Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) angesiedelt sein, das allerdings nur vier Stellen für diese Aufgabe erhält. Dem BALM kommt die Aufgabe zu, Bußgelder „als äußerstes Mittel“ zu verhängen.
Laut dem Medienbericht wird das Gesetz frühestens Ende 2024 oder Anfang 2025 in Kraft treten. Bis alles eingerichtet ist und die Vorgaben für Bußgelder stehen, dürfte es allerdings 2026 werden.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Auch in London darf die Polizei die umstrittene Gesichter-Suchmaschine PimEyes nicht nutzen. Dennoch sollen Beamt:innen die Seite mehr als 2.000 Mal aufgerufen haben. Jetzt hat die Behörde den Zugriff über Dienstgeräte gesperrt.

Die Londoner Polizei soll mehr als 2.000 Mal die Seite der Suchmaschine PimEyes aufgerufen haben. Das berichtet das britische Nachrichtenmedium i-News und verweist auf Dokumente, die es mit Hilfe einer Informationsfreiheitsanfrage erhalten hat. Demnach hätten Dienstcomputer der Behörde in den ersten drei Monaten des Jahres 2.337 Mal die Seite von PimEyes besucht.
Mit der Suchmaschine kann man anhand eines Fotos im offenen Internet nach weiteren Bildern dieser Person suchen. Sie ist hoch umstritten, weil die Suche auf biometrischen Daten basiert. Dafür werden offen im Internet verfügbare Fotos automatisch ausgewertet – ohne eine Zustimmung der Betroffenen einzuholen. Zugleich ist PimEyes öffentlich zugänglich, sodass damit jede beliebige Person andere anhand eines Schnappschusses identifizieren kann. Denn die Suchergebnisse von PimEyes sind Links zu den Fundorten im Netz, die häufig entscheidende Hinweise auf eine Person liefern.
Die Europäische Union hat deswegen in ihrer KI-Verordnung vor kurzem genau das verboten, was PimEyes überhaupt erst möglich macht: massenhaft Gesichtsbilder aus dem offenen Internet zu sammeln und zum Aufbau einer Datenbank biometrisch auszuwerten. PimEyes könnten in der EU damit hohe Strafen drohen, sobald die Regeln umgesetzt werden.
Londoner Polizei redet Zugriffe klein
Die Londoner Polizei setzt bereits mehrere Formen von Gesichtserkennung ein, etwa um Aufnahmen aus öffentlichen Kameras in Echtzeit auszuwerten oder rückwirkend mit ihren Datenbanken abzugleichen.
Allerdings müssen Beamt:innen dafür den offiziellen Weg beschreiten: Gesucht werden darf nur nach Personen auf Fahndungslisten und auch nur in der nationalen Polizeidatenbank (Police National Database, PND). Dabei handelt es sich um eine zentrale Datenbank mit Bildern von Straftäter:innen, die von Behörden im ganzen Land hochgeladen und vom Innenministerium verwaltet werden.
Mit PimEyes könnten die Beamt:innen hingegen im offenen Internet nach Zielpersonen suchen. Und das, ohne dass diese Suchen von Vorgesetzten abgesegnet werden müssten.
Ein Sprecher der Londoner Polizei sagte gegenüber i-News, die Aufrufe der Website würden noch nicht heißen, dass Beamt:innen die Gesichtersuche auch tatsächlich eingesetzt hätten. „Es gibt eine Reihe von Gründen, warum ein Beamter nachforschen könnte, was PimEyes ist, insbesondere im Lichte der jüngsten Presseberichte.“ Nachdem die Zugriffe bekannt geworden seien, habe man „die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen verschärft und den Zugang zu dieser Website auf Met-Geräten gesperrt“. Offiziell soll die Suche mit PimEyes ohnehin nicht erlaubt gewesen sein.
PimEyes: Bilder entfernen lassen gegen Zahlung
PimEyes wurde ursprünglich von zwei polnischen Studierenden gegründet. Nach kritischen Berichten unter anderem von netzpolitik.org verlagerte die Firma ihren Sitz zunächst auf die Seychellen und antwortete nicht mehr auf Fragen. Auch Datenschutzbehörden wurden aktiv.
Seit 2022 gehört PimEyes nun einem Sicherheitsforscher aus Georgien: Georgi Gobronidze. Er bemüht sich, das Image des Unternehmens zu wandeln, und vermarktet PimEyes als Hilfe zur digitalen Selbstverteidigung statt als Stalking-Werkzeug. Frauen sollen damit Bilder aus dem Netz entfernen lassen können, die ohne ihr Einverständnis hochgeladen wurden. Für diesen „Premium-Service“ nimmt PimEyes eine monatliche Gebühr.
In Deutschland war die Suchmaschine zuletzt in den Schlagzeilen, weil Journalist:innen mit ihrer Hilfe eine Spur zur seit Jahrzehnten gesuchten ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette entdeckt hatten. Polizeigewerkschaften forderten daraufhin, auch die Polizei solle „solch hilfreiche Software“ einsetzen dürfen und monierten, „Polizeibehörden in anderen EU-Nachbarstaaten“ seien bereits weiter.
Allerdings nutzen auch deutsche Polizeibehörden bereits seit langem Gesichtserkennung, etwa das „Gesichterkennungssystem“ des BKA, das Bilder mit Aufnahmen bekannter Straftäter:innen in der eigenen Datenbank INPOL abgleicht. Dass die Polizei hingegen mit Suchmaschinen wie PimEyes wahllos nach Gesichtern im Internet sucht, ist laut der Einschätzung von Fachleuten nicht mit Grundrechten vereinbar. Dabei würden massenhaft Unverdächtige ins Visier geraten.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Die Regierung hat sich im Koalitionsvertrag von Hackbacks klar distanziert, doch aus der CDU und von Ex-Geheimdienstlern kommt aktuell die Forderung nach digitaler Eskalation. Dabei verdreht Ex-BND-Chef Schindler die Tatsachen und stellt das Zurückhacken als Abwehr dar. Doch ein Hackback ist ein Gegenangriff und damit eine offensive Angriffsmaßnahme. Ein Kommentar.

Seit die Bundesregierung nach einem IT-Angriff auf SPD-E-Mails dafür Russland verantwortlich gemacht hat, fordern sowohl Außenministerin Annalena Baerbock als auch Unionspolitiker Konsequenzen nach dem Hack. Während Baerbock nicht benennt, welche weiteren Konsequenzen neben dem Abzug des Botschafters aus Moskau noch folgen sollen, wird in der Union die alte Debatte um offensive IT-Gegenangriffe aufgewärmt.
Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, Oberst a.D. und Ex-Präsident des Reservistenverbandes, und der Ex-Geheimdienstchef und heutige Berater Gerhard Schindler gehören zu den prominentesten Vertretern, die nun wieder mehr Massenüberwachungsmaßnahmen und offensive IT-Angriffe aus Deutschland heraus fordern. Schindler möchte für die Geheimdienste die Erlaubnis zur „strategischen Kommunikationsaufklärung im Inland“, ein Euphemismus für das automatisierte Durchleuchten sämtlicher Telekommunikationsdaten innerhalb Deutschlands.
Statt einer „Überwachungsgesamtrechnung“, die von der Bundesregierung geplant ist, solle besser eine „Bedrohungsgesamtrechnung“ erstellt werden, sekundiert ihm Kiesewetter. Er erklärte, die aktuellen IT-Angriffe würden zeigen, dass Deutschland ein „Kriegsziel“ Russlands sei, wie er dem ZDF sagte. Deswegen wünscht er sich auch, dass deutsche Geheimdienste die Erlaubnis zu sogenannten Hackbacks erhalten sollen. Er sagte: „Wir müssen auch IT-technisch gegeneskalieren.“
Doch diese Eskalation verstößt gegen geltendes Recht und soll es gerade nicht geben: Die Ampelregierung hatte im Koalitionsvertrag diesen Hackbacks eine Absage erteilt, auch in der nationalen Sicherheitsstrategie positioniert sich die Regierung dagegen. Der Koalitionsvertrag sagt klar: „Hackbacks lehnen wir als Mittel der Cyberabwehr grundsätzlich ab.“ Dafür gibt es gute Gründe, die vor allem in der Natur digitaler Angriffe liegen.
Denn was ist ein „Hackback“? Wörtlich meint es Zurückhacken, im übertragenen Sinne also einen Gegenschlag ausführen. Und für einen Gegenschlag braucht man vor allem einen sichtbaren und greifbaren Gegner. Die hinreichend sichere Feststellung, wer hinter einem ausgefeilten IT-Angriff steckt, ist aber keine leichte, sie ist manchmal auch gar nicht möglich, und sie dauert aufgrund des Nachvollziehens des Angriffsweges auch oft längere Zeit. Und die Gefahr, beim Hackback den Falschen zu erwischen, ist auch nicht wegzudiskutieren. Die Vorstellung von Nicht-Technikern, die Hacken nur aus Vorabendserien kennen, dass man mal eben einem Angreifer durch Zurückhacken das Handwerk legen könnte, ist schlicht ausgemachter Unsinn. Das zeigt auch gerade der aktuelle SPD-E-Mail-Vorfall, dessen Untersuchung viele Monate in Anspruch nahm.
Denkt man an kriegerische Auseinandersetzungen im physischen Raum, mag ein solches Vorgehen nachvollziehbar sein: Du beschießt mich, ich schieße zurück. Wenn ich allerdings nicht gesichert herausfinden kann, wer auf mich schießt, dann wird es kompliziert. Im Digitalen ist das der Normalfall: So gut wie kein Angreifer ist sofort sicher auszumachen. Zudem sind keine abgrenzbaren zivilen und militärischen Räume vorhanden, denn das Schlachtfeld wären unsere zivilen Netze.
Ex-BND-Chef Schindler geht also kategorisch fehl und verdreht die Tatsachen, wenn er in einem aktuellen Interview für Hackbacks trommelt und dabei behauptet, Hackbacks seien „ein Mittel, um Cyberangriffe abzuwehren“.
Denn ein solcher Gegenangriff ist eine klar offensive Maßnahme. Eine Abwehr eines Angriffs bestünde darin, den Angreifer daran zu hindern, seinen Angriff fortzusetzen und Schaden von sich selbst fernzuhalten. Diesen Unterschied kennt natürlich auch der Ex-Geheimdienstler. Die Falschdarstellung dient dem Zweck, das offensive Zurückhacken zu verniedlichen und eben als bloße Abwehrmaßnahme hinzustellen.
„Wir müssen alle unsere IT in Ordnung bringen“
Jeder IT-Angriff muss zuallererst gut untersucht und die Eintrittswege der Angreifer nachvollzogen werden, um weitere Angriffe zu verhindern und die oft sabotierten und dysfunktionalen Computersysteme wieder so an den Start zu bringen, dass nicht gleich der nächste Angriff ins Haus steht. An jedem einzelnen Tag im Jahr finden derart viele IT-Angriffe statt, dass man von einer IT-Sicherheitskrise sprechen muss und es nicht mal mehr gemeldet wird, wenn der Schaden nicht enorm groß ist.
Eigentlich müssten angesichts dieses für Wirtschaft, Behörden und Private ausgesprochen bedrohlichen Zustandes Sofortmaßnahmenpläne umgesetzt werden, die der Bedeutung von sicheren IT-Systemen für uns alle angemessen wären. Die BSI-Chefin Claudia Plattner brachte es nach dem Bekanntwerden der jüngsten Angriffe auf den Slogan: Wir müssen alle unsere IT in Ordnung bringen.
Das ist zweifellos richtig, aber man möchte den Nachsatz hinzufügen, dass dies eine wahre Mammutaufgabe ist, die politisch flankiert werden müsste. Aber wirklich das letzte, was die ohnehin desolate Gesamtsituation in der IT-Sicherheit jetzt braucht, sind auch noch deutsche Geheimdienste und Militärs, die ihre Cyberwaffen laden und sich im Zurückhacken versuchen.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Hausdurchsuchung! Handy her! Was passiert mit Menschen, die unerwartet ins Visier des Staates geraten? In „Systemeinstellungen“ erzählen Betroffene, wie sich ihr Leben schlagartig verändert. Ein Podcast über Ohnmacht und erschüttertes Vertrauen.

Wenn die Polizei plötzlich an deine Tür hämmert und ruft: Hausdurchsuchung! Was tun? In unserem neuen Podcast „Systemeinstellungen“ erzählen wir die Geschichten von Menschen, die unerwartet ins Visier des Staates geraten. Wir treffen unter anderem eine 15-jährige Klima-Aktivistin, die sich vor der Polizei bis auf die Unterwäsche ausziehen muss. Einen Soziologen, dessen Familie monatelang überwacht wird. Eine engagierte Pfarrerin auf dem Land, die ihre Kirche für Geflüchtete in Not öffnet und plötzlich die Polizei im Pfarrhaus hat.
Sie alle haben unterschiedliche Hintergründe, aber eines gemeinsam: den Schock, als plötzlich Beamt*innen ihre Schlafzimmer, ihre Handys, ihr privates und dienstliches Leben durchsuchen. Die erste von sieben Episoden, „Link-Extremismus“, erscheint am Freitag, 10. Mai. Ab dann folgt jede Woche eine weitere Episode – überall, wo es Podcasts gibt.
Den Trailer gibt es schon jetzt, hier im eingebetteten Player auf der Seite oder zum Download als MP3. Für diesen Podcast gibt es auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken im WebVTT-Format.
Abonniere den Podcast, wo und wie es Dir gefällt:
- per RSS-Feed
- im Podcatcher Deines Vertrauens
- bei Apple Podcasts, Spotify, Audible, Deezer oder Pocket Casts
- alle Episoden findest Du auch auf unserer Übersichtsseite netzpolitik.org/systemeinstellungen
- Host und Produktion: Serafin Dinges
- Redaktion: Anna Biselli, Chris Köver, Ingo Dachwitz, Sebastian Meineck
- Cover-Design: Lea Binsfeld
- Titelmusik: Daniel Laufer
- Kontakt: podcast@netzpolitik.org
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Die Zusammenführung der Entwicklung ihrer Mediathek-Software unter dem Titel „Streaming OS“ nutzen ARD und ZDF auch dazu, diese Open Source zu machen. Neben den üblichen Vorteilen von Freier und Open-Source-Software sind damit auch spezifische Vorteile für öffentlich-rechtliche Medien verbunden.

Hier bei netzpolitik.org gibt es eine eigene Kolumne zum Thema „Öffentliches Geld – Öffentliches Gut!“. Wechselnde Autor:innen gehen dabei der Frage nach, wo mit öffentlichen Mitteln finanzierte, digitale Güter mithilfe von freien Lizenzen zu digitalen Gemeingütern gemacht werden. Ganz besonders einleuchtend ist das bei öffentlich finanzierter Software-Entwicklung: Hier sollten freie Open-Source-Lizenzen längst der Normalfall sein, auch weil es Herstellerabhängigkeiten und Parallelentwicklungen reduziert sowie regionale Software-Wirtschaft fördert.
In der Realität passiert der Umstieg auf Freie und Open-Source-Software selten im großen Stil, auch wenn immer mehr Open-Source-Komponenten zur Anwendung kommen. Das gilt auch für den Bereich öffentlich-rechtlicher Medien, wo im Zuge der Digitalisierung immer größere Beträge in Softwareentwicklung und -beschaffung fließen. Auch dort kommt natürlich längst an verschiedenen Stellen Open-Source-Software zum Einsatz. Allein die BBC listet auf einer eigenen Seite über 40 Open-Source-Projekte.
„OS“ steht für „Operating System“, aber auch für „Open Source“
Trotzdem ist die heutige gemeinsame Ankündigung von ARD und ZDF, ihre Mediathekentwicklung auf Open-Source-Basis zusammenzuführen, ein bemerkens- und begrüßenswerter Schritt. In der Pressemeldung zum Projekt mit dem Namen „Streaming OS“ ist von einer „der größten Open Source-Initiativen in Deutschland“ die Rede. Die Abkürzung OS steht dabei zwar für „Operating System“, die Doppeldeutigkeit der Abkürzung wird aber sicher gern in Kauf genommen.
Interessant an der Ankündigung ist auch die organisatorische Umsetzung. So soll das Projekt „von einem gemeinsamen, schlank besetzten ‚OS-Office'“ gesteuert werden, zusätzlich aber für den Mediathek-Betrieb eine gemeinsamen Tochterfirma gegründet werden. Dieser Schritt entspricht ziemlich genau einer Empfehlung des von den Ländern eingerichteten „Zukunftsrats“. In dessen Gutachten hieß es:
ARD, ZDF und Deutschlandradio gründen eine gemeinsame, rechtlich verselbstständigte Gesellschaft für die Entwicklung und den Betrieb einer technologischen Plattform, die alle Technologien für digitale Plattformen und Streaming vereinheitlicht und betreibt.
Spezifische Open-Source-Vorteile für öffentlich-rechtliche Medien
Auch ich habe mich seit Jahren dafür ausgesprochen, die Mediathekentwicklung auf ein solides Open-Source-Fundament zu stellen (beispielsweise auf der re:publica 2019, gemeinsam mit Jan-Hendrik-Passoth im Tagesspiegel oder in meiner Rede zum Otto-Brenner-Preis 2023). Neben den bereits angesprochenen, allgemeinen Vorteilen von Open-Source-Software und der besonderen Sinnhaftigkeit bei öffentlicher Finanzierung gibt es aber auch noch weitere Gründe, warum es gerade für öffentlich-rechtliche Medien so sinnvoll ist, Open Source zu forcieren:
- Open Source als Public Value jenseits des Programms: Zentrale Aufgabe öffentlich-rechtlicher Medien ist es, „Public Value“, also gesellschaftlichen Nutzen zu stiften. Die Open-Source-Initiative von ARD und ZDF belegt, dass das nicht nur in Form von Public-Value-Programmen möglich ist, sondern auch durch Investitionen in digitale Gemeingüter wie eben Open-Source-Software.
- Open Source als Unterstützungs- und Kooperationsangebot an private Medien: Verbunden damit sind auch Potenziale zur Stärkung des Medienstandorts Deutschland. Viele Komponenten digitaler Medienangebote sind über verschiedene Anbieter hinweg gleich, werden aber trotzdem parallel entwickelt. Für private Medienhäuser bietet der Einsatz von (Teilen von) Streaming OS die Möglichkeit für Kosteneinsparungen in Bereichen, die nicht wettbewerbsdifferenzierend sind.
- Open Source als unilaterale Europäisierung: Vor allem aber ist Streaming OS auch eine Einladung an andere öffentlich-rechtliche Medien in Europa, mit einzusteigen. Allerdings ohne, dass vorab in langen Meetings ein (ohnehin unrealistisches) gemeinsames Softwareprojekt definiert wird. Stattdessen ist Streaming OS ein Angebot zur Kooperation, ohne sich völlig in wechselseitige Abhängigkeiten zu begeben. Im Zweifel erlauben es Open-Source-Lizenzen immer, auf Basis des bislang gemeinsam entwickelten Codes getrennte Wege zu gehen.
Zusammengefasst ist es also überaus erfreulich, dass es ARD und ZDF nicht dabei belassen, die Entwicklung ihrer Mediathek-Software unter einem Dach zusammenzulegen, sondern diesen Schritt dazu nutzen, auf Open Source zu setzen. Die ohnehin notwendigen Änderungen und Neuentwicklungen bieten dafür das perfekte Gelegenheitsfenster. Bleibt zu hoffen, dass viele andere öffentlich-rechtliche Medien in Europa, allen voran die Schweizer SRG und der Österreichische ORF, auf den Open-Source-Zug aufspringen.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Nach dem italienischen Kulturgüterschutzgesetz ist eine spezielle Verwaltungsabgabe zu zahlen, wenn historische Gebäude und Kunstwerke abgebildet werden. Ein Urteil des Stuttgarter Landgerichts hat den kuriosen Gebührenforderungen nun endlich Grenzen gesetzt. Und das Kulturministerium in Rom ergänzte die Vorschrift immerhin um Ausnahmen für die Wissenschaft.
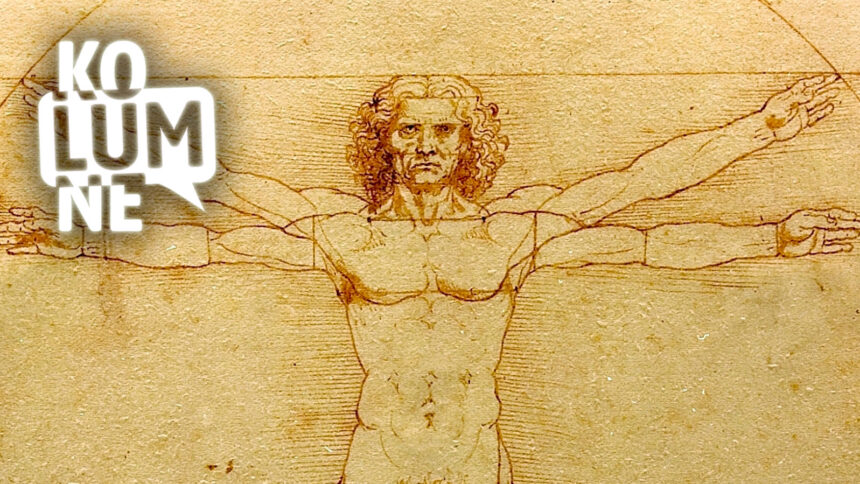
Seit dem Jahr 2004 enthält das italienische Kulturgüterschutzgesetz eine weltweit wohl einzigartige Vorschrift: Wer die Abbildung eines historischen Gebäudes oder Kunstwerks nutzen möchte, das zum Kulturerbe Italiens gezählt wird, muss dafür eine Abgabe zahlen. Das kann das Foto des römischen Kolosseums in einem Buch oder die Abbildung von Botticellis „Geburt der Venus“ auf einer Webseite sein. Die Regelung entspricht einer Lizenzgebühr – ungeachtet der Tatsache, dass der urheberrechtliche Schutz der verwendeten Werke freilich längst abgelaufen ist.
Die seltsame Norm fristet in der Praxis bislang ein Schattendasein. Vielen Nutzer:innen ist die Zahlungspflicht völlig unbekannt. Und die zuständigen staatlichen Kulturinstitutionen treiben die Gebühr nur äußerst selten ein. Einige prominente Fälle sind jedoch jedoch öffentlich geworden und zeigen, wie absurd die Regelung ist.
Deshalb gibt es an der Regelung auch vielstimmige Kritik. Insbesondere seitdem die Europäische Union 2019 das Recht zur freien Nutzung von Abbildungen gemeinfreier Kunstwerke anerkannt hat (in Art. 14 der DSM-Richtlinie), fordert unter anderem die Organisation Communia, die Vorschrift aufzuheben.
Auch der italienische Rechnungshof kritisiert die „Postkarten-Steuer“
Zu den prominentesten Kritikern der Regelung gehört überraschenderweise der italienische Rechnungshof. Im vergangenen Jahr plante das italienische Kulturministerium, neue Gebühren-Mindestsätze einzuführen. Der Rechnungshof kritisierte daraufhin, dass die „Postkarten-Steuer“ den erklärten Bemühungen des italienischen Staates entgegenlaufe, Open Access zu fördern. Auch liege der freie Zugang zu digitalen Kulturgütern im wirtschaftlichen Interesse Italiens. Darüber hinaus verkenne die Gebührenpflicht „operative Besonderheiten des Internets“, also den kulturellen Wert, den das Teilen von Inhalten im Netz hat.
Eine Vielzahl von Verbänden und Organisationen schloss sich der Kritik an, darunter auch Wikimedia Italia. In der Wikipedia finden sich abertausende Fotos des reichen italienischen Kulturerbes – auch dank des großen Erfolgs des alljährlichen Fotowettbewerbs „Wiki Loves Monuments“. Wegen der bestehenden Rechtsunsicherheit kann dieser Wettbewerb in Italien nur mit erheblichem bürokratischem Aufwand durchgeführt werden.
Die Diskussion um die Vorschrift nimmt mitunter auch absurde Auswüchse an. So untersagte ein italienisches Gericht der Männerzeitschrift GQ im März 2023, ein Model in der Pose von Michelangelos „David“ auf dem Titelblatt abzubilden. Auch große italienischen Tageszeitungen griffen das Thema auf.
Ravensburger gewinnt im Puzzle-Streit
Im vergangenen Jahr schwappte die Debatte dann nach Deutschland. Ein staatliches Museum in Venedig hatte zunächst in Italien Klage gegen den Spieleverlag Ravensburger erhoben. Das schwäbische Unternehmen hatte die weltberühmte Zeichnung des „Vitruvianischen Menschen“ von Leonardo da Vinci aus dem 15. Jahrhundert auf einem Puzzle abgebildet.
Die venezianischen Gerichte gaben dem Museum Recht und verhängten gegen das Puzzle sogar einen weltweiten Verkaufsstopp. Dagegen erhob Ravensburger Klage vor dem Landgericht Stuttgart. Der Verlag wollte feststellen zu lassen, dass die Vergütungspflicht nur innerhalb Italiens besteht.
Das Verfahren erfuhr hierzulande nur wenig Aufmerksamkeit, hat aber große wirtschaftliche und praktische Bedeutung. Potenziell könnte eine große Zahl an Produkten in den Anwendungsbereich der italienischen Vorschrift fallen – von kunsthistorischen Nachschlagewerken bis zu alltäglichen Designs, die von italienischer Kunst inspiriert sind. Ravensburger allein vertreibt zahlreiche Produkte mit Motiven aus dem italienischen Kulturerbe. Bislang hat der Verlag jedoch nur den Vertrieb des von der Klage erfassten Puzzles eingestellt.
Im März dieses Jahres verkündete das Landgericht Stuttgart seine Entscheidung. Demnach kann die „Postkarten-Steuer“ im Ausland nicht geltend gemacht werden, da das italienische Kulturgüterschutzgesetz aufgrund des sogenannten Territorialitätsprinzips nur innerhalb Italiens Anwendung findet. Die Gebührenforderungen müssen sich deshalb auf den Vertrieb innerhalb Italiens beschränken, so das Gericht (Az. 17 O 247/22).
Wie der SWR berichtete, ist der Rechtsstreit damit aber nicht beendet. Das italienische Museum hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Daher bietet Ravensburger das Puzzle bislang auch noch nicht wieder an. Fest steht aber schon jetzt: Auf dem italienischen Markt wird der Verlag das Produkt auch nach der Gerichtsentscheidung nur verkaufen können, wenn er auch die geforderte Gebühr bezahlt.
Ausnahmen für die Wissenschaft
Immerhin veranlasste die breite Kritik das italienische Kulturministerium im März dazu, die Gebührenvorschrift um Ausnahmen zu ergänzen. Demnach soll es fortan wenigstens zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt sein, italienische Kulturgüter kostenfrei abzubilden. Unternehmen wie Ravensburger wird das jedoch nur wenig helfen.
Anfang April kommentierte die Tageszeitung „Corriere della Sera“ das Stuttgarter Urteil und zitierte dabei den italienischen Kulturpolitiker Giuliano Volpe. Auf die Frage, ob das Gesetz nicht erforderlich sei, um das italienische Kulturerbe vor „unwürdigen“ Nutzungen zu schützen, entgegnete Volpe: „Schlechter Geschmack oder gar Vulgarität können nicht gesetzlich geregelt werden, dagegen muss man eher mit den Waffen der Kultur, der Bildung, aber auch der Ironie und Satire kämpfen.“ Mitunter münden solche Versuche des Gesetzgebers nämlich in Realsatire.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Die 18. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 13 neue Texte mit insgesamt 121.606 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.
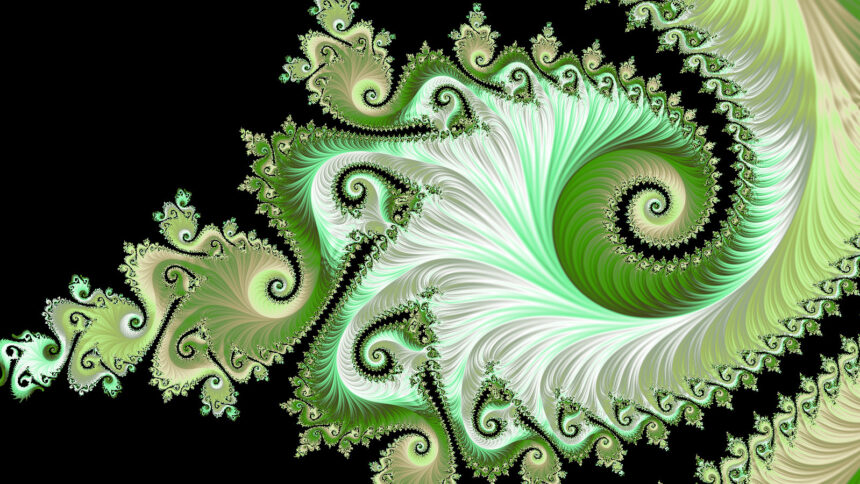
Liebe Leser:innen,
heute ist Tag der Pressefreiheit und es steht nicht gut um sie. Laut Reporter ohne Grenzen haben sich die Bedingungen für journalistische Arbeit im vergangenen Jahr weltweit deutlich verschlechtert. Es gibt mehr Repression, mehr Zensur, mehr Überwachung. Alles andere als rosige Aussichten im Superwahljahr 2024, in dem rund die Hälfte der Weltbevölkerung dazu aufgerufen ist, wählen zu gehen.
Deutschland ist im Ranking ein paar Plätze nach oben gerückt. Das ist jedoch kein Grund zu größerer Freude. Zwar werden Journalist:innen hierzulande auf Demos seltener physisch angegriffen als im Vorjahr. Reporter ohne Grenzen geht jedoch weiterhin von einer hohen Dunkelziffer an Übergriffen aus. Vor allem aber verdankt sich das bessere Abschneiden dem Negativtrend in anderen Ländern.
Diesem Negativtrend will sich Europa offenkundig nicht verschließen. Am Dienstag weichte der Europäische Gerichtshof seine einst grundrechtsfreundliche Haltung zur Vorratsdatenspeicherung weiter auf. Die anlasslose Massenüberwachung ist demnach auch zulässig, um jegliche Art von Straftaten zu verfolgen – und sogar Urheberrechtsverletzungen.
Chloé Berthélémy vom Dachverband europäischer Digital-Rights-Organisationen (EDRi) sieht in dem EuGH-Urteil eine „traurige Wende“. Im politischen Kontext der zunehmenden Unterdrückung von Journalist:innen, Menschenrechtsverteidigern und der Zivilgesellschaft untergrabe das Gericht auf gefährliche Weise das Recht, online anonym zu bleiben, so die Expertin.
Bundesinnenministerin Faeser hingegen witterte umgehend Morgenluft. Der EuGH habe entschieden, so Faeser in einer Pressemitteilung, dass „eine Pflicht zur Speicherung von IP-Adressen zur Verbrechensbekämpfung nicht nur ausdrücklich zulässig ist, sondern auch zwingend erforderlich ist“. Der Zombie der anlasslosen Massenüberwachung ist damit in dieser Woche vollends auf die politische Bühne zurückgekehrt.
Wer angesichts solcher untoten Debatten etwas Positives sucht, sollte unseren Longread der Woche lesen. Die Gastautor:innen Maria Farrell und Robin Berjon plädieren darin für eine Verwilderung des Internets und damit für ein vielfältiges und selbstverwaltetes Netz jenseits der ummauerten Gärten der Tech-Giganten.
Habt ein wildes Wochenende!
Daniel
Bundesjustizministerium: Ein Jahr kein Digitale-Gewalt-Gesetz
Das Justizministerium will in seinem Eckpunkten zu einem Digitale-Gewalt-Gesetz auch Unternehmen schützen. Gerichtsentscheidungen machen deutlich, dass dieser Plan nicht mit dem Europarecht vereinbar ist. Ob und wann es zu einem Gesetz kommt, das Betroffene von digitaler Gewalt schützt, ist offen. Von Anne Roth –
Artikel lesen
Breakpoint: Hilfe, die Fundis kommen!
Bibelverse und Babywindeln statt Doppelbelastung und Dauerstress: Der Content der „Tradwives“ weckt die Sehnsucht nach einem entspannteren Leben. Soziale Medien werden so zum Sprachrohr einer reaktionären Bewegung. Von Carla Siepmann –
Artikel lesen
Mastodon: Gemeinwohlorientierte Digitalisierung braucht Unterstützung statt Steine im Weg
Das Finanzamt hat den Hauptentwicklern von Mastodon die Gemeinnützigkeit aberkannt. Wer Digitalisierung und digitale Souveränität vorantreiben will, sollte die Entwicklung von freier und offener Software als gemeinnützig anerkennen. Ein Kommentar. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
Österreich: Ermittlungen gegen Bürgerrechtsorganisation wegen angeblichen Hackings
Immer wieder geraten Menschen oder Organisationen, die ethisch verantwortungsvoll Sicherheitslücken aufdecken, in den Fokus von strafrechtlichen Ermittlungen. Dieses Mal hat es Österreichs bekannteste Datenschutz-NGO epicenter.works erwischt. Die Ermittlungen wurden erst nach zwei Jahren eingestellt. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
Civil Liberties Union for Europe: Medienbericht fordert besseren Schutz vor Staatstrojanern
Die EU brauche strengere Regeln beim Einsatz von Staatstrojanern, fordert die NGO Civil Liberties Union for Europe in einem Bericht zur europäischen Medienlandschaft. Außerdem nehme das Vertrauen in Medien insgesamt ab – auch in Deutschland, wo die Presse verhältnismäßig viel Glaubwürdigkeit genießt. Von Tomas Rudl –
Artikel lesen
Facebook und Instagram: EU-Kommission untersucht Desinformation und Drosselung politischer Inhalte
Kurz vor der Europawahl wird Meta verdächtigt, nicht genug gegen Desinformation zu tun. Die EU-Kommission befürchtet weitere Verstöße gegen den Digital Services Act, etwa erschwerten Datenzugang für Forscher:innen. Auch die Drosselung politischer Inhalte könnte regelwidrig sein. Von Maximilian Henning –
Artikel lesen
EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung: „Traurige Wende beim Schutz der Privatsphäre“
Der Europäische Gerichtshof ändert seine bisher grundrechtsfreundliche Haltung zur Vorratsdatenspeicherung und erlaubt in einem Urteil die anlasslose Überwachung sogar bei Urheberrechtsverletzungen. Grundrechte-Organisationen sind entsetzt und sprechen von einer „Wende“. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
EuGH-Urteil: Gericht lässt Massenüberwachung des Internets zu
Der EuGH hat gerade den massenhaften und automatisierten Zugriff auf IP-Adressen genehmigt. Mit dem heutigen Urteil räumt das Gericht ein, dass es seine Rechtsprechung ändern wird, wenn seine Urteile nicht umgesetzt werden. Ein Gastkommentar. Von Gastbeitrag –
Artikel lesen
Essay: Wir müssen zurück zum wilden Internet
Das Internet ist zu einer ausbeuterischen und fragilen Monokultur geworden. Aber wir können es renaturieren, indem wir die Lehren von Ökologen nutzen. Von Gastbeitrag, Maria Farrell, Robin Berjon –
Artikel lesen
Digitalpolitischer Rückblick: Fünf Jahre von der Leyen
Im Juni wählt Europa ein neues Parlament und bekommt auch eine neue EU-Kommission. Deren alte Präsidentin wird wahrscheinlich auch die neue sein: Ursula von der Leyen. Was hat die mächtigste Frau der Welt in den vergangenen fünf Jahren netzpolitisch erreicht? Wir prüfen ihre Versprechen. Von Maximilian Henning –
Artikel lesen
Reporter ohne Grenzen: Pressefreiheit verschlechtert sich weltweit
Die Pressefreiheit steht weiterhin unter Druck. In vielen Regionen haben sich die Arbeitsbedingungen für Journalist:innen verschlechtert. Reporter ohne Grenzen warnt im weltweiten Superwahljahr vor weiteren Repressionen. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
SEO-Spam: Warum Google immer schlechter wird
Die Suche im Internet gestaltet sich immer schwieriger. Ein Grund dafür sind sogenannte Affiliate-Links, mit denen Website-Anbieter auf einfache Weise Geld verdienen. Gegen deren Suchmaschinenoptimierung sind Dienste wie Google Search oder Microsoft Bing offenbar machtlos. Von Nora Nemitz –
Artikel lesen
Überwachungstechnik: Polizei observiert mit Gesichtserkennung
Laut eigener Aussage nutzt die sächsische Polizei ein Gesichtserkennungssystem mit Echtzeit-Funktion. Einsätze erfolgen auch in Berlin. Dort macht der Senat erstmals technische Details bekannt. Von Matthias Monroy –
Artikel lesen
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Laut eigener Aussage nutzt die sächsische Polizei ein Gesichtserkennungssystem mit Echtzeit-Funktion. Einsätze erfolgen auch in Berlin. Dort macht der Senat erstmals technische Details bekannt.

Bei der Videoüberwachung gehörte die Polizei in Sachsen schon immer zu den Pionieren. Leipzig war die erste deutsche Stadt, in der seit dem Jahr 1996 ein öffentlicher Platz am Bahnhof rund um die Uhr mit Kameras beobachtet wird. Ein Jahrzehnt später war das Bundesland Vorläufer bei der Überwachung mit fliegenden Kameras. Weitere zehn Jahre später beschaffte die Polizei in Görlitz und Zwickau in der Oberlausitz stationäre und mobile Systeme zur Videoüberwachung, die Kennzeichen und Gesichter aufnehmen und abgleichen können – letzteres allerdings retrograd, also im händischen Verfahren.
Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die sächsische Polizei auch ein heimliches Observationssystem mit hochauflösenden Kameras und Gesichtserkennung einsetzt. Diese können entweder in parkenden Fahrzeugen verbaut oder stationär montiert werden. So kann die Polizei ermitteln, ob sich eine verdächtige Person an einem bestimmten Ort aufgehalten hat.
Hinweise auf „Personen-Identifikations-System“ (PerIS)
Details zur Funktionsweise unterliegen in Sachsen gemäß einer Polizeidienstvorschrift der Geheimhaltung, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage des „nd“. Ob es sich bei dieser „Observationstechnik für verdeckte Maßnahmen“ um Elemente des „Personen-Identifikations-Systems“ (PerIS) aus der Oberlausitz handelt, ist unklar. Jedoch gibt es Hinweise darauf: Der erste bekanntgewordene Einsatz der verdeckten Observationstechnik aus Sachsen erfolgte in Berlin im Bereich der „grenzüberschreitenden Bandenkriminalität“. Diese Ermittlungen führt die Polizeidirektion Görlitz, die das PerIS als erste sächsische Behörde 2020 angeschafft hat.
Für die Ermittlungen in Berlin hat das Landeskriminalamt aus Görlitz ein Amtshilfeersuchen an die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt gestellt. Das bestätigt die Berliner Senatsverwaltung für Inneres in der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Linken-Abgeordneten Niklas Schrader, der auch innenpolitischer Sprecher der Fraktion ist. Darin finden sich auch technische Details zu der Anlage. Das mobile Überwachungssystem nimmt demnach Kennzeichen von durchfahrenden Kraftfahrzeugen sowie Gesichtsbilder der Fahrer:innen und Beifahrer:innen auf.
Abgleich mit Lichtbildern
Die Aufnahmen werden mit bereits im System vorhandenen Lichtbildern abgeglichen. Diese Datenbank speist sich aus Bildern, die von Polizisten „händisch ausgewählt und manuell in das System eingepflegt“ werden. Ein automatischer Abgleich mit anderen polizeilichen oder europäischen Informationssystemen erfolgt angeblich nicht.
Das System kann Gesichtsbilder „mit der zeitlichen Verzögerung von wenigen Sekunden“ verarbeiten, wie die Berliner Staatsanwaltschaft bereits dem „nd“ mitgeteilt hatte. Alle im Umkreis erfassten Personen würden mit Bildern von Tatverdächtigen aus einem konkreten Ermittlungsverfahren abgeglichen, erklärte der Sprecher. Entdeckt die Software eine verdächtige Person, wird der Fund durch einen Polizeibeamten überprüft.
„Bei den wesentlichen technischen Komponenten beziehungsweise Details handelt es sich um ein System hochauflösender Kameras, die qualitativ sehr gute Bilder auch bei Dunkelheit und unter schlechten Witterungsbedingungen erstellen können“, erläutert nun der Berliner Innensenat. Einsätze der Technik erfolgten „zur Identifizierung von Tatverdächtigen und zur Aufhellung von Fluchtrouten und bei der Tat genutzten Wegen bekannter Tatverdächtiger“.
Um welche konkreten Verfahren es sich handelt, beantwortet der Senat nicht. In einem Fall werde wegen einer „internationalen Kraftfahrzeugverschiebung“ ermittelt, in dem anderen wegen eines schweren Raubes an einer Tankstelle. Diese Tat werde einer Gruppierung zur Last gelegt, die „regelmäßig bandenmäßig schwere Tresordiebstähle“ an Tankstellen begehen soll. Einer der Vorfälle sei „zu einem schweren Raub eskaliert“.
Staatsanwaltschaft Berlin sieht „keine flächendeckende Überwachung“
Als rechtliche Grundlage für den Einsatz der biometrischen Überwachung nennt die Berliner Staatsanwaltschaft den Paragraf 98a der Strafprozessordnung. Er erlaubt eine Rasterfahndung bei einer Straftat von erheblicher Bedeutung, wenn andere Methoden „erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert“ wären. Nach diesem Gesetz dürfen alle von der Technik erfassten Personen „mit anderen Daten maschinell abgeglichen werden“.
Wie oft die Polizei Sachsen die „Observationstechnik für verdeckte Maßnahmen“ bereits eingesetzt hat und ob diese Einsätze erfolgreich waren, ist dort angeblich mangels Statistiken nicht bekannt. In Berlin habe es „bislang eine bestätigte Personenidentifizierung“ gegeben, heißt es in der Antwort.
Bei den Observationen mit Videokameras geraten sämtliche Personen im Umkreis ins polizeiliche Raster. Die Staatsanwaltschaft Berlin sieht darin „keine flächendeckende Überwachung“. Tobias Singelnstein, Professor für Strafrecht an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, widerspricht: „Eine solche Maßnahme greift in erheblichem Maße in die Rechte von völlig Unbeteiligten ein, weil je nach Umständen eine Vielzahl von Personen erfasst wird“. Die Strafprozessordnung erlaube eine solche Maßnahme nicht.
Auch der Fragesteller Niklas Schrader steht der heimlichen Technik äußerst kritisch gegenüber: „Der Einsatz von biometrischer Gesichtserkennung von Polizeifahrzeugen aus ist ein schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte auch von Unbetroffenen. Indem sich Berlin entsprechende Technik aus Sachsen ausleiht, werden Schritt für Schritt die Voraussetzungen geschaffen, diese flächendeckend durchzusetzen“, warnt der innenpolitische Sprecher der Berliner Linken und fordert vom Senat „ein deutliches Bekenntnis, vom Einsatz biometrischer Überwachung und auch der Ausweitung von polizeilicher Videoüberwachung im öffentlichen Raum Abstand zu nehmen“.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Die Suche im Internet gestaltet sich immer schwieriger. Ein Grund dafür sind sogenannte Affiliate-Links, mit denen Website-Anbieter auf einfache Weise Geld verdienen. Gegen deren Suchmaschinenoptimierung sind Dienste wie Google Search oder Microsoft Bing offenbar machtlos.

Die Google-Suche, so inzwischen ein weitverbreiteter Eindruck, spuckt längst nicht mehr so gute Ergebnisse aus wie noch vor wenigen Jahren. Wer beispielsweise nach hochwertigen Kopfhörern oder schönen Reisezielen sucht, erhält als Suchergebnis vor allem Links auf kommerzielle Blogs oder Vergleichsportale.
Die dortigen Texte sind in den meisten Fällen nicht sonderlich aussagekräftig – und zunehmend ist fraglich, ob sie von einem Menschen geschrieben wurden. Die Produktempfehlungen sind oft mit einem Link versehen, der einen zu Amazon oder einem anderen kommerziellen Anbieter weiterleitet.
Insofern sind die Seiten kaum mehr als ein Zwischenstopp auf dem Weg zum Händler.
Google-Suche als Forschungsthema
Den Eindruck, dass Internetsuchen in den vergangenen Jahren qualitativ schlechter geworden sind, bestätigt auch eine Studie von Forscher*innen der Universität Leipzig und der Bauhaus-Universität Weimar.
Für die Dauer eines Jahres haben die Wissenschaftler:innen knapp 7.400 Abfragen zu Produktbewertungen beobachtet. Dabei konzentrierten sie sich nach eigenen Angaben „auf die Suche nach Produktbewertungen, die wir aufgrund des inhärenten Interessenkonflikts zwischen Nutzern, Such- und Inhaltsanbietern als besonders anfällig für Affiliate-Marketing betrachten.“
Die Studienergebnisse veröffentlichten die Forschenden zu Beginn dieses Jahres. Demnach sind Webseiten, die Produkte vergleichen und zu kommerziellen Anbietern verlinken, maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Internetsuche schlechter wird. Und nicht nur Google ist davon betroffen, sondern laut den Wissenschaftler:innen auch Microsoft Bing und DuckDuckGo.
Affiliate-Link-Farmen
Die entsprechenden Webseiten bieten Inhalte an, die mit sogenannten Affiliate-Links versehen sind. Klicken Seitenbesucher:innen auf diese Links und kaufen dann ein entsprechendes Produkt, verdienen die Betreiber der Affiliate-Seiten zwischen 5 und 15 Euro pro Kauf.
Kleineren Bloggern kann dies durchaus dabei helfen, mit ihrer Website Einnahmen zu erzielen. Daneben gibt es jedoch inzwischen weitaus mehr Seiten, die nichts anderes als Affiliate-Link-Farmen sind.
Diese Seiten präsentieren meist eine Fülle an Produkten und versehen dieses mit Affiliate-Links zu verschiedenen Händlern, die dieses Produkt anbieten. Abgesehen von den Werbeinhalten und den Links sind diese Seiten relativ inhaltsleer.
Darüber hinaus sind Affiliate-Links oft auch auf Kochseiten wie Chefkoch.de zu finden. Seiten ohne Affiliate-Links, die etwa auf Angebote von Supermärkten verweisen, sind meistens sehr viel weiter unten auf der Suchseite zu finden.
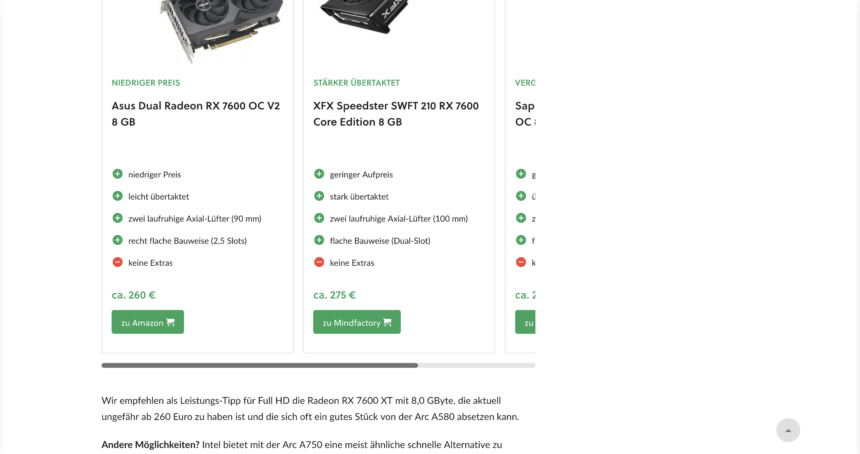
Katz- und Maus-Spiel
Damit Internetnutzer:innen auf die Webseiten kommen, betreiben deren Betreiber gezielt Suchmaschinenoptimierung (SEO). Sie halten ihre Website fortwährend auf dem neuesten Stand, passen sie aktuellen Suchtrends an und aktualisieren dafür Textüberschriften sowie Metadaten.
Bei alledem achten die Betreiber insbesondere darauf, eine möglichst breite Palette potenzieller Suchbegriffe abzudecken. Auf diese Weise gelingt es ihnen, dass ihre Webseiten in den Ergebnissen der Google-Suche relativ weit oben angezeigt werden, ohne dass die Seitenbetreiber dafür viel Geld investieren müssen.
Google und andere Suchmaschinenbetreiber bemühen sich offenbar darum, gegen diese Art der gezielten SEO vorzugehen. So zeigt die Studie, dass die Flut an Affiliate-Link-Webseiten in den oberen Suchergebnissen nach jedem internen Update der Google-Suche vorübergehend zurückging. Das Ganze gleicht jedoch einem Katz- und Maus-Spiel. Denn schon nach relativ kurzer Zeit füllte sich die erste Ergebnisseite wieder mit den Seiten der Affiliate-Link-Farmen.
Besserung ist vorerst nicht in Sicht
Solange Google dieses Problem nicht nachhaltig in den Griff bekommt, solange die Nutzer:innen der Suche auch qualitativ schlechtere Suchergebnisse erhalten – gespickt mit Webseiten, die kaum relevanten Inhalt enthalten, und die nur einem Zweck dienen: dem Seitenbetreiber Einnahmen zu bescheren.
Immerhin kennzeichnen viele Anbieter ihre Inhalte als kommerzielles Angebot, etwa indem sie Affiliate-Links mit dem Symbol eines Einkaufswagens versehen. So erhalten die Besucher:innen dieser Seiten eine Ahnung davon, dass der Anbieter mit ihren Klicks Geld verdient. Und zugleich bestätigt sich damit einmal mehr auch bei ihnen der Eindruck, dass die Google-Suche immer schlechter wird.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.